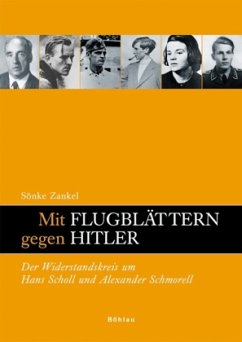Über den Widerstandskreis um die Geschwister Scholl und Alexander Schmorell ist bereits viel geschrieben worden. Eine Würdigung aus wissenschaftskritischer Perspektive fehlte jedoch bisher. Sönke Zankel legt nun eine erste wissenschaftliche Gesamtdarstellung der so genannten »Weissen Rose« vor, die nicht nur die Motive der Studenten, sondern auch ihr Umfeld hinreichend durchleuchtet. Bereits 2006 hat er einen Teil seiner Forschungsergebnisse in dem ebenfalls im Böhlau Verlag erschienenen Band »Die Weisse Rose war nur der Anfang. Geschichte eines Widerstandskreises« ( ISBN 978-3-412-09206-1) veröffentlicht. Die nun vorliegende Publikation ermöglicht durch umfangreiche biographische Studien der Widerstandskämpfer, vor allem aber durch die Aufarbeitung ihres ideengeschichtlichen Hintergrunds eine ganzheitliche Wahrnehmung des Phänomens. Sie bietet eine umfassende Analyse aller Flugblätter und geht systematisch der Frage nach, inwieweit der Kreis durch verschiedene Mentoren beeinflusst wurde. Erstmals wird auch das Helferumfeld der Münchner Studenten in den Blick genommen. Nicht zuletzt ist es durch die Erforschung der Wirkungsgeschichte des Kreises gelungen, mehrere Widerstandsaktionen aufzuspüren, die der bisherigen Forschung verborgen geblieben waren.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Einen kritischen Blick wirft Hans Mommsen auf Sönke Zankels Buch "Mit Flugblättern gegen Hitler", der umfangreichen Dissertationsfassung seiner vor zwei Jahren erschienenen, umstrittenen Publikation "Die weiße Rose war nur der Anfang". Der Versuch des Autors, den Widerstandskreis um Hans und Sophie Scholl zu "entmythologisieren", das angeblich zu positive Bild der "Weißen Rose" zu dekonstruieren, ist seines Erachtens auch in der vorliegenden Langfassung gescheitert. Er hat eine ganze Reihe von Einwänden, die gegen die Arbeit sprechen: Mangel an Empathie; eine zersplitternde, in eine Vielzahl von Einzelaspketen zerfallende Darstellung; Überbetonung der Heterogenität der Gruppe; Vernachlässigung des gemeinsamen moralischen Motivs und der praktischen Zielsetzung der Gruppe usw. Generell hält er dem Autor vor, zu überzogenen, spitzfindigen und willkürlichen Interpretationen zu neigen und das nötige Augenmaß vermissen zu lassen. Die These, Hans und Sophie Scholl hätten bei ihrer Flugblatt-Aktion unter Drogen gestanden, scheint ihm etwa überaus zweifelhaft. Daneben moniert Mommsen Mängel der Gliederung sowie stilistischer Natur, die die Lektüre des Buchs strapaziös machen. Positiv wertet er hingegen Zankels Ausweitung der Quellenbasis für die Geschichte der "Weißen Rose".
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH