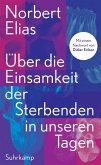Gibt es von uns Menschen und unseren Gefühlen unabhängige moralische Wahrheiten? Können wir sie erkennen? Und gibt es in der Menschheitsgeschichte einen moralischen Fortschritt hin zu diesen Wahrheiten? Das sind die großen Fragen, denen sich der weltberühmte amerikanische Philosoph Thomas Nagel in seinem neuen Buch widmet.
Nagel setzt sich mit aktuellen Forschungen der Moralpsychologie, der Kognitionswissenschaft und der Evolutionären Psychologie auseinander, die unseren Zugang zu moralischem Wissen sowie die Rolle, die Gefühle dabei spielen, empirisch untersuchen. Solche subjektivistischen und reduktionistischen Darstellungen der Moral können ihn jedoch nicht überzeugen - eine Alternative bietet der moralische Realismus. Dieser sieht sich allerdings mit dem historischen Wandel der Moral konfrontiert, die nicht die zeitlose Gültigkeit wissenschaftlicher Wahrheiten besitzt. Vielmehr sind moralische Wahrheiten auf ganz spezifische Weise mit historischen Entwicklungen verknüpft, wie Nagel in diesem ebenso konzisen wie tiefschürfenden Buch zeigt.
Nagel setzt sich mit aktuellen Forschungen der Moralpsychologie, der Kognitionswissenschaft und der Evolutionären Psychologie auseinander, die unseren Zugang zu moralischem Wissen sowie die Rolle, die Gefühle dabei spielen, empirisch untersuchen. Solche subjektivistischen und reduktionistischen Darstellungen der Moral können ihn jedoch nicht überzeugen - eine Alternative bietet der moralische Realismus. Dieser sieht sich allerdings mit dem historischen Wandel der Moral konfrontiert, die nicht die zeitlose Gültigkeit wissenschaftlicher Wahrheiten besitzt. Vielmehr sind moralische Wahrheiten auf ganz spezifische Weise mit historischen Entwicklungen verknüpft, wie Nagel in diesem ebenso konzisen wie tiefschürfenden Buch zeigt.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Sehr interessiert nähert sich Rezensent Uwe Justus Wenzel diesem Buch, dem ein etwas griffigerer Titel womöglich gut gestanden hätte. Der amerikanische Philosoph Thomas Nagel beschäftigt sich damit unter anderem mit dem Status sogenannter "moralischer Wahrheiten", wie etwa, dass Sklaverei verwerflich ist - eine Wahrheit, die für Nagel zwar überzeitlich gilt, aber dennoch einem historischen Lernprozess unterworfen ist, was sie von naturwissenschaftlichen Wahrheiten unterscheidet. Soll heißen: Menschen hatten vermutlich auch schon früher ein ungutes Gefühl beim Blick auf Sklaverei, aber sie konnten erst entsprechend dieses Gefühls handeln, fasst Wenzel Nagel zusammen, sobald ihnen ein Grund für dieses Handeln "zugänglich" ist. Wenzel führt diesen Gedanken entlang des Buches anhand der Frage nach der Legitimität politischer Ordnung aus und bringt ihn mit der von Nagel vertretenen Schule des "moralischen Realismus" in Verbindung, der auf einem emphatischen Wahrheitsbegriff beruht. Ziemlich abstrakt und komplex ist dieses Argument, findet Wenzel, auf die Unterscheidung die zwischen utilitaristischer und deontologischer Ethik eingeht. Letztendlich ist es diesem Buch wichtiger, schließt der Rezensent, Fragen zu stellen, als sie abschließend zu beantworten. Wenzel lobt zwar die Subtilität dieser Schrift, hätte sich aber doch hier und da etwas wagemutigere Erkenntnisse gewünscht.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Seit einem guten halben Jahrhundert bereichert [Nagel] die transatlantische philosophische Diskussion um differenzierende Argumentationen, die sich nicht selten einem Entweder-oder verweigern.« Uwe Justus Wenzel Frankfurter Allgemeine Zeitung 20250819

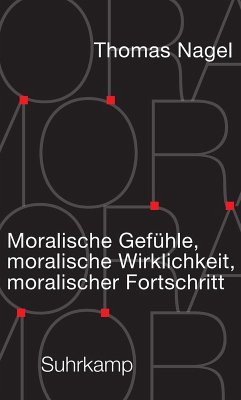

![What Is It Like to Be a Bat? / Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?. Englisch/Deutsch. [Great Papers Philosophie] What Is It Like to Be a Bat? / Wie ist es, eine Fledermaus zu sein?. Englisch/Deutsch. [Great Papers Philosophie]](https://bilder.buecher.de/produkte/68/68015/68015424m.jpg)