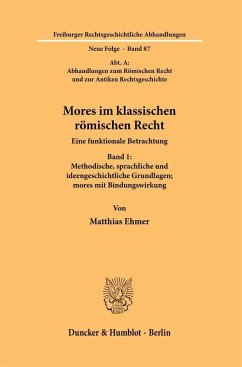Relevanz und Wirkweise der 'mores' im römischen Recht sind seit Jahrhunderten umstritten. Bislang wurden stets Sachfragen - etwa nach dem Gewohnheitsrecht - an die Quellen herangetragen. Diese Untersuchung wählt einen anderen Weg: Im Lichte der jüngeren Forschung zur römischen und romanistischen Methodik werden mit wortmonographischem Vollständigkeitsanspruch aus den juristischen Quellen des klassischen Rechts die Funktionen der 'mores' induziert.
Unmittelbare Bindungswirkung entfalten nur wenige als 'mores bezeichnete Rechtsprinzipien, die auf dem Konsens des römischen Volkes beruhen. Andere 'mores' binden nur kraft Anerkennung durch den Princeps als Lokalrecht oder durch die Juristen als Auslegungsgrundsatz. 'Contra bonos mores' dient im ediktalen Kontext der Abgrenzung erlaubten und verbotenen Verhaltens. Im Übrigen berufen sich v.a. spätklassische Juristen im Wege kreativer 'inventio' auf das Verdikt, um die Kohärenz innerhalb der Rechtsordnung oder zwischen Rechts- und Werteordnung zu sichern.
Unmittelbare Bindungswirkung entfalten nur wenige als 'mores bezeichnete Rechtsprinzipien, die auf dem Konsens des römischen Volkes beruhen. Andere 'mores' binden nur kraft Anerkennung durch den Princeps als Lokalrecht oder durch die Juristen als Auslegungsgrundsatz. 'Contra bonos mores' dient im ediktalen Kontext der Abgrenzung erlaubten und verbotenen Verhaltens. Im Übrigen berufen sich v.a. spätklassische Juristen im Wege kreativer 'inventio' auf das Verdikt, um die Kohärenz innerhalb der Rechtsordnung oder zwischen Rechts- und Werteordnung zu sichern.