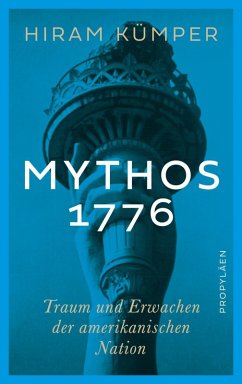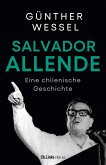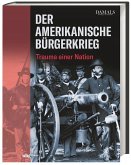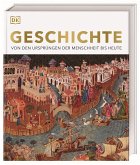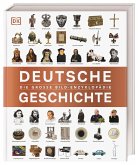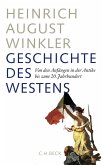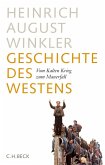Wie beeinflussen die Gründungsmythen der USA unsere politische Gegenwart?
Für das innen- und außenpolitische Handeln der USA im 21. Jahrhundert spielt der Rückbezug auf die Unabhängigkeitserklärung von 1776 und der Mythos vom amerikanischen »Freiheitsstreben« eine zentrale Rolle. Dies gilt einmal mehr seit dem erneuten Amtsantritt von Donald Trump, der das Land seitdem grundlegend verändert. Aber ging es den Gründervätern wirklich nur um Freiheit, Liberalität und Menschenrechte? Und welche Folgen zeitigt dieser Mythos in einer Gegenwart politischer Extreme und gesellschaftlicher Spaltung?
Der Historiker Hiram Kümper analysiert die Gründungsgeschichte und das Politikverständnis der USA, die ihren »way of life« spätestens seit dem 19. Jahrhundert in die Welt exportierten. Dem Heldenepos vom »Freiheitsstreben« einer Gruppe weißer Männer setzt er eine vielgestaltige Erzählung vom Kampf um politische Partizipation, um die Beteiligung an Macht und »Fleischtöpfen« entgegen. So kommen auch jene in den Blick, die die Kosten dieses Selbstbewusstseins trugen: Millionen versklavte Schwarze, Indigene und Menschen, die Amerika groß machten, während ihre eigenen Spielräume klein blieben.
Für das innen- und außenpolitische Handeln der USA im 21. Jahrhundert spielt der Rückbezug auf die Unabhängigkeitserklärung von 1776 und der Mythos vom amerikanischen »Freiheitsstreben« eine zentrale Rolle. Dies gilt einmal mehr seit dem erneuten Amtsantritt von Donald Trump, der das Land seitdem grundlegend verändert. Aber ging es den Gründervätern wirklich nur um Freiheit, Liberalität und Menschenrechte? Und welche Folgen zeitigt dieser Mythos in einer Gegenwart politischer Extreme und gesellschaftlicher Spaltung?
Der Historiker Hiram Kümper analysiert die Gründungsgeschichte und das Politikverständnis der USA, die ihren »way of life« spätestens seit dem 19. Jahrhundert in die Welt exportierten. Dem Heldenepos vom »Freiheitsstreben« einer Gruppe weißer Männer setzt er eine vielgestaltige Erzählung vom Kampf um politische Partizipation, um die Beteiligung an Macht und »Fleischtöpfen« entgegen. So kommen auch jene in den Blick, die die Kosten dieses Selbstbewusstseins trugen: Millionen versklavte Schwarze, Indigene und Menschen, die Amerika groß machten, während ihre eigenen Spielräume klein blieben.