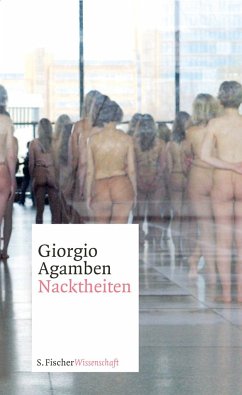Das neue Buch von Giorgio Agamben umkreist in kurzen, literarisch-philosophischen Denkbildern den Körper in seiner Entblößung, in seiner Nacktheit: von der Bulimie zu den glorreichen Körpern der Heiligen, die weder essen noch lieben, von den verborgenen theologischen Implikationen der Nacktheit zu den neuen Formen unpersönlicher Identität, welche die biometrischen Dispositive der Menschheit auferlegen. Zielpunkt aller Überlegungen ist die Untätigkeit, nicht als Muße oder Trägheit, sondern als Paradigma menschlicher Handlung und einer neuen Politik.

Giorgio Agamben sucht wie kein zweiter Philosoph nach den antiken, frühchristlichen und theologischen Gründungsakten und Weichenstellungen, die unser Leben in Recht, Gesellschaft, Politik und Staat bis heute kontaminieren. In seinem Essayband "Nacktheiten" arbeitet er heraus, wie all die Formen der Nacktheit, die in Pornographie, Werbung, Fernsehen oder Kunst erscheinen, von theologischen Setzungen durchdrungen sind. Wenn Agamben der Künstlerin Vanessa Beecroft, die gern wenig bekleidete Frauen in Museen vorführt, vorwirft, sie liefere damit ihre Darstellerinnen der "Komplizenschaft von Ware und Theologie" aus, wird sein Anliegen deutlich. Weil Beecroft keine Ahnung von den theologischen Implikationen der Nacktheit hat, hält sie ihre Performance-Schmarren für Kritik. Nacktheit aber, wie Beecroft sie ausstellen lässt, hat nur wenig mit den gezeigten Körpern zu tun, sie folgt einem geistigen Schöpfungsakt, aus dem dann die Inbesitznahme der Körper durch Kirche, Wissenschaft und Staat in der Geschichte der abend- und morgenländischen Kultur folgte. Den vorläufigen Gipfel der wissenschaftlichen Verwaltung der Nacktheit durch Recht und Staat stellen die modernen biometrischen Verfahren zur Kennzeichnung von Menschen über Fingerabdruck, DNA und Irisfotometrie da.
Begonnen hat das alles mit dem Sündenfall. Erst seit dem Sündenfall gibt es Nacktheit, vorher gab es Unbekleidetheit, was nicht dasselbe ist. Gott hatte Adam und Eva nicht in einem geistigen, sondern in einem tierischen Körper erschaffen, doch dieser Körper wurde von der Gnade umhüllt. Deshalb kannte der Körper weder Krankheit und Tod noch die "libido", die unkontrollierbare Erregung seiner Schamteile. Nach dem Sündenfall entriss Gott den Menschen den Mantel der Gnade. Sie schämten sich und griffen zum Feigenblatt. Der Unterschied konnte aber nur bemerkt werden, wenn eine Veränderung im Sein der Menschen stattgefunden hatte. "Es muß, mit anderen Worten, eine metaphysische, eine die Seinsweise des Menschen berührende Veränderung eingetreten sein und nicht bloß eine moralische." Das Zitat hat Agamben dem Artikel "Theologie des Kleides" des katholischen Theologen Erik Peterson, 1934 veröffentlicht, entnommen. Peterson, einer der wenigen modernen Theologen, der über die Nacktheit nachgedacht hat, gehört neben Augustinus zu den Quellen, an denen Agamben die Veränderungsmacht geistiger Setzungen am Körper demonstriert. Dass er damit auch zeigen kann, was moderne Krankheitsphänomene wie Bulimie oder Anorexie mit religiösen Fasten- und Festschmauszeremonien zu tun haben, tut seiner philologischen Ernsthaftigkeit keinen Abbruch. Man muss auch keine Angst haben, dass einem das schöne Buch die Feiertage vermiest. Agamben ist kein Anti-Theologe. Als Ausblick zitiert er aus dem Talmud: "Drei Dinge nehmen die kommende Zeit vorweg, die Sonne, der Sabbat und der tashmish" (ein Wort, das sowohl Geschlechtsakt als auch Stuhlgang bedeuten kann).
Cord Riechelmann
Giorgio Agamben: "Nacktheiten". Aus dem Italienischen von Andreas Hiepko. S. Fischer, 200 Seiten, 19,95 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Nicht viel hält Rezensent Uwe Justus Wenzel von der seit Jahren nicht nur in Deutschland grassierenden Verehrung des italienischen Philosophen Giorgio Agamben. Die eigentlich immer gleiche Methode dieses Denkers glaubt er auch in diesem Band mit gesammelten kürzeren Texten beobachten zu können. Diesmal werde eben die "Nacktheit" gedeutet mit Hinweis auf die theologische Herkunft unserer Betrachtung derselben - das sei der übliche Doppelschritt: der Verweis auf die Wirkungsmacht der Theologie bei gleichzeitig behauptetem Bemühen um die Entschärfung der Theologoumena. Wenzel gibt zu, dass er vieles in den Texten nicht versteht und schließt daraus offenbar, dass sie oft schlechterdings unverständlich sind. Umso entschiedener werde das alles jedoch von Agamben verkündet. In Inhalt und Gestus ist hier für wirkliche Zeitdiagnostik, bedauert der sichtlich ungehaltene Wenzel, wenig zu holen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH