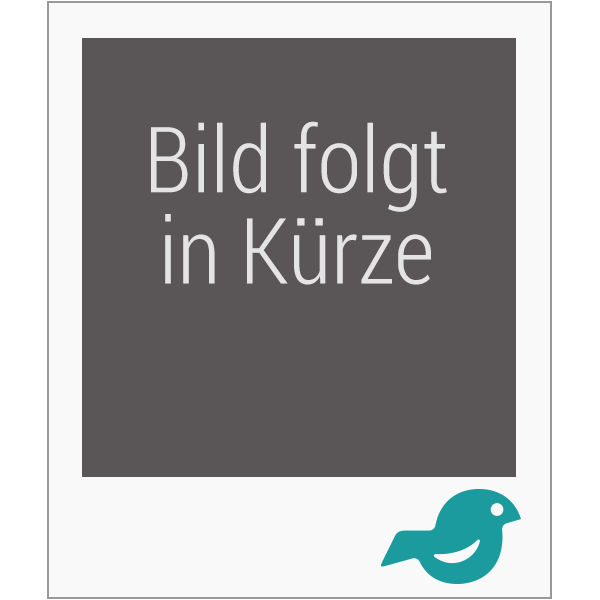Helius Eobanus Hessus (1488 - 1540) gilt bis heute als einer der berühmtesten Humanistendichter der Frühen Neuzeit. Durch einen engen Freund, der sein Leben beschrieb, entstand die erste Biographie eines deutschen Renaissancepoeten.
Der lateinische Text wird hier begleitet von einer ersten deutschen Übersetzung, einer Einleitung samit weiterführender Bibliographie und einem Kommentar.
Der lateinische Text wird hier begleitet von einer ersten deutschen Übersetzung, einer Einleitung samit weiterführender Bibliographie und einem Kommentar.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Mit Joachim Camerarius' deutsch-lateinischem Werk "Narratio de Helio Eobano Hesso / Das Leben des Dichters Helius Eobanus Hessus" wird "ein spannendes Stück europäischer Identitätsgeschichte" vorgeführt, urteilt Wolfgang Neuber. Deutlich wird anhand des Buches, das aus dem Jahre 1553 datiert, dass es die Gesellschaft und die Freunde seien, "die das moderne Individuum profilieren" - und insofern sei es nicht nur für ein akademisches Publikum interessant. Geradezu romanhafte Züge erhalte der Text durch seine "digressive, anekdotische Struktur", die immer wieder den weit verzweigten Freundeskreis - darunter einige der bedeutendsten Gelehrten jener Zeit - einbeziehe. Camerarius erzählt die Geschichte seines Freundes Helius Eobanus Hessus als ein "ständiges Zwiegespräch mit Adam Krafft, einem weiteren Humanisten und Freund". Interessant findet Neuber, wie der Autor sich um Ausgewogenheit, um Naturalismus bemühe. Neben den Stärken treten dabei auch die Schwächen eines Charakters ganz ungeschminkt hervor. So rühmt der Biograf seinem toten Freunde Eobanus zwar seine körperliche Schönheit nach, kritisiert zugleich jedoch dessen Unfähigkeit, mit Geld umzugehen, und sein autodestruktives Trinkverhalten, wie der Rezensent erzählt. Es sei ein Charakteristikum der Biographie der Frühen Neuzeit, schreibt der Rezensent, "dass sie ihren Antrieb und Motivationsgrund nicht mehr in einer heiligenden oder wenigstens moralischen Vollendung des Menschen findet". Statt dessen nehme sie den Menschen als soziales Produkt in den Blick.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH