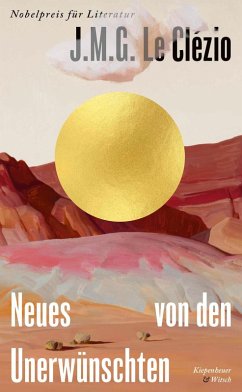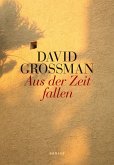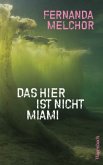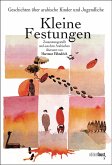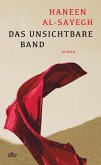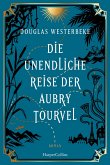In seinem neuen Buch erzählt J. M. G. Le Clézio von denjenigen, die zwar den westlichen Wohlstand mit erzeugen, denen man aber keine Teilhabe daran zugesteht. Anklagend und poetisch zugleich.
Acht Erzählungen, die geografisch den halben Erdball umspannen, Mauritius, Peru, das Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko, den Libanon, Frankreich, und in denen der Literaturnobelpreisträger denjenigen eine Stimme gibt, über deren Leben die Geschichte normalerweise hinweggeht, die die Welt nur erfahren und kaum gestalten können.
So wie Maureez, die es trotz schwierigster Kindheit schafft, andere mit ihrer Stimme zu bezaubern. Oder eine Handvoll Jugendlicher - Grenzgänger zwischen Mexiko und den USA. Die beiden jungen Brüder Marwan und Mehdi, die nach der Zerstörung ihres Dorfes durch den Libanon irren. Oder ein tunesischer Arbeiter, der sich in seiner französischen Unterkuft nach seiner Familie sehnt. Sie alle verdienen es, gesehen zu werden, und J.M.G. Le Clézio erzählt ihre Geschichten.
Acht Erzählungen, die geografisch den halben Erdball umspannen, Mauritius, Peru, das Grenzgebiet zwischen den USA und Mexiko, den Libanon, Frankreich, und in denen der Literaturnobelpreisträger denjenigen eine Stimme gibt, über deren Leben die Geschichte normalerweise hinweggeht, die die Welt nur erfahren und kaum gestalten können.
So wie Maureez, die es trotz schwierigster Kindheit schafft, andere mit ihrer Stimme zu bezaubern. Oder eine Handvoll Jugendlicher - Grenzgänger zwischen Mexiko und den USA. Die beiden jungen Brüder Marwan und Mehdi, die nach der Zerstörung ihres Dorfes durch den Libanon irren. Oder ein tunesischer Arbeiter, der sich in seiner französischen Unterkuft nach seiner Familie sehnt. Sie alle verdienen es, gesehen zu werden, und J.M.G. Le Clézio erzählt ihre Geschichten.
»Kunst kann Wunder wirken und glücklich machen. [...] Und Le Clézio weiß das nicht nur, er kann das auch« Uli Hufen Deutschlandfunk Büchermarkt 20250815
»Knapp, schnörkellos und eindringlich präsentierte Geschichten, die beim Leser Empathie erzeugen und die trotz allem immer einen Funken Hoffnung und Versöhnlichkeit bewahren.« Julia Zarbach ORF Ö1 "Ex Libris" 20251207