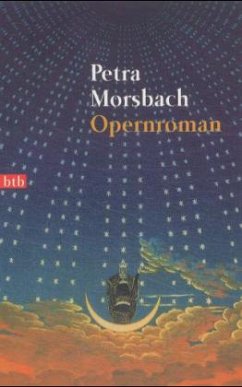Der große Opernroman von Petra Morsbach
Höhen und Tiefen gehören in der Oper zum künstlerischen Alltag. Daß in der Welt des Musiktheaters wie sonst nirgendwo Triumph und Niederlage nahe beieinander liegen, erzählt Petra Morsbach in diesem vom Literarischen Quartett hochgelobten Roman über das Leben von Opernkünstlern - von der Diva bis zum Beleuchter, vom Korrepetitor bis zum Intendanten.
Ort der Handlung: Das Theater in Neustadt, eine Provinzbühne mit großem Opernrepertoire. Hinter den Kulissen geht es mindestens so dramatisch zu wie auf der Bühne. Da opfern die einen für die Kunst ihr Leben, während andere die Kunst skrupellos in den Dienst ihrer Karriere stellen. Hier wird intensiver gelebt, aber auch intensiver gelitten als anderswo. Die Oper ist ein Ort der Extreme.
Höhen und Tiefen gehören in der Oper zum künstlerischen Alltag. Daß in der Welt des Musiktheaters wie sonst nirgendwo Triumph und Niederlage nahe beieinander liegen, erzählt Petra Morsbach in diesem vom Literarischen Quartett hochgelobten Roman über das Leben von Opernkünstlern - von der Diva bis zum Beleuchter, vom Korrepetitor bis zum Intendanten.
Ort der Handlung: Das Theater in Neustadt, eine Provinzbühne mit großem Opernrepertoire. Hinter den Kulissen geht es mindestens so dramatisch zu wie auf der Bühne. Da opfern die einen für die Kunst ihr Leben, während andere die Kunst skrupellos in den Dienst ihrer Karriere stellen. Hier wird intensiver gelebt, aber auch intensiver gelitten als anderswo. Die Oper ist ein Ort der Extreme.

Schicksal auf Honorarbasis, Kraftwerk auf Pump: Petra Morsbachs "Opernroman" / Von Eleonore Büning
Feuerwehrlöscherrot ist dies Büchlein, bis tief in die Vorsatzblätter hinein. Rot züngelt das Sehnsuchtssegel des Fliegenden Holländers auf der Pappbanderole, dazu ein ultimativer Titel wie eine Trompetenfanfare, C-Dur und fortissimo: "Opernroman". Wer sich so eine tolle Verpackung ausdenkt, gleichviel ob Autor, Lektor oder PR-Agent, der rechnet ganz klar mit einem populären Mißverständnis.
Angeblich ist Oper etwas für leidenschaftlich Verliebte und Verrückte. Man nennt diese Gattung heute, in Anlehnung an Alexander Kluges bekenntnishaften Opernfilm, gern ein "Kraftwerk der Gefühle". Sie soll den Verstand verwirren, das reine, heiße Herzblut in Wallung bringen und möglicherweise, weil schon die Opernlibretti in aller Regel den Gesetzen der Logik entraten, einen gewissen Hang zu bizarren Mysterien haben, zu unterirdischen Seen, abstürzenden Kronleuchtern, tödlichen Giftgasanschlägen und plötzlicher Selbstentzündung.
Das sind keine musikhistorischen Tatsachen, nur Gerüchte, die freilich eine gute Romangrundlage abgeben. Der ultimative Roman der Oper wurde auch längst geschrieben, nämlich zu Beginn unseres Jahrhunderts von Gaston Leroux, später mehrfach verfilmt und von dem Komponisten Andrew Lloyd-Webber, der ein sicheres Gespür für das Modische hat, mittels halloweenreifer Hammondorgelchromatik wieder rücküberführt in Musik und aufs Musical reduziert. Josef Haslingers "Opernball", Kreislers wüst-genialer Opernboogie, dies alles und mehr klingt mit, wenn man Petra Morsbachs zweiten großen Roman aufschlägt. Man sieht sich angenehm enttäuscht. So blutig und lüstern das Versprechen draußen, so nett und nüchtern die Alltagsgegeschichten, die drinnen erzählt werden.
Jan liebt John und Babs liebt Harry. Harry ist verliebt in die Liebe, weshalb alle Frauen hinter ihm her sind, ausgenommen Andrea. Andrea liebt, wenn überhaupt, nur unglücklich verheiratete Männer, Saskia liebt niemanden außer sich selbst, Laurent liebt die Musik, Dave den Alkohol und so fort. Das Personenverzeichnis der Liebenden und Verliebten ist noch mindestens dreimal so lang, alle treten nacheinander in kurzen Soli mit ihren Nöten und Freuden nach vorn an die Romanrampe und sind im übrigen auf das engste in Duz- und Arbeitsgemeinschaft miteinander verhäkelt. Schnell und geschickt zappt sich die Autorin von einem Leben ins nächste, manche Episode ist nur eine Miniatur, eine knappe halbe Druckseite lang. Ein Panoptikum von Allerweltsmenschen mit konfektionierten Gedanken und Gefühlen, kurz und kühl distanziert beschrieben. Sie führen Dialoge, die im wirklichen Leben kein Mensch führen würde. Überhaupt haben diese vielen Figuren ein exemplarisch kurzes, gesichtsloses Leben: Legt man das rotflammende Buch beiseite, hat man sie schon vergessen.
Dabei geht es darin um die üblichen lebensnahen Probleme, die jeden etwas angehen: Einer hat Aids, ein anderer Ärger mit dem Chef oder Streit mit den Kollegen, wieder ein anderer hat zu Hause eine Frohnatur und zu viele Kinder, alle miteinander haben Angst vor der Arbeitslosigkeit und zu wenig Geld. Kein Phantom der Oper in Sicht, kein Mordkrimi, nicht mal ein klitzekleiner Totschlag - obgleich dieser Roman doch eigentlich von nichts anderem handeln will als davon, wie das Gefühlskraftwerk funktioniert. Alle dramatis personae arbeiten auf Honorarbasis oder als Festangestellte an einem mittelgroßen deutschen Stadttheater, als erste Primadonna, zweite Geige, Inspizientin, Ballerina, Kantinenwirtin, Regieassistentin, Korrepetitor und so weiter. Alle könnten genausogut in einer anderen Firma arbeiten, deren Mitarbeiter ständig vom Exitus bedroht und darum auf einen prima Teamgeist angewiesen sind: in einem Luxushotel wie die "Girl Friends" beispielsweise oder, noch besser, in einer Intensivstation wie in der Serie "Emergency Room". Nicht umsonst ist der Erzählduktus dieses Buches so drehbuchartig knapp gehalten, ist die Abfolge der Episoden so patchworkartig unvermittelt, sind die Dialoge so klischeehaft und künstlich. Petra Morsbach hat, offenbar mit Bedacht, für ihren Opernroman die sehr zeitgemäße Form der Seifenoper gewählt.
Die Konstruktion ist bewundernswürdig: Staffelweise ranken sich die kurzen Spots jeweils um eine große Repertoireoper, deren Einstudierung und Aufführung. Außerdem ist der gesamte Roman mit Ouvertüre und Coda großrahmig angelegt wie eine Grande Operá, wobei mittendrin, wie auch bei Meyerbeer üblich, manch ein rührender, realistischer Winkel ausgeleuchtet wird: vernachlässigte Künstlerkinder, in der Kulisse spielend; die zarte Freundschaft zwischen einem altersweisen Schauspieler und einer kleinen, hungrigen Ballettratte. Der vierte und fünfte Akt hat dann, wie es sein muß, je eine wirkungsvolle Klimax.
Erstens das "Fest", in dem der banale Gefühlshaushalt unverhofft aus dem Ruder läuft und in höhere Sphären entflieht: Die Opernmenschen fangen in ihrer Freizeit von selber zu singen an, weil sie nicht anders können und weil die Musik nun mal Himmelsmacht ist. Zweitens die "Vorbereitung eines Konzerts", eine sternstundenhaft geglückte Probe des "Deutschen Requiems" von Johannes Brahms, die der Regieassistentin Babs die Tränen ins Auge treibt und sie zur Erkenntnis der pantheistischen und "unumstößlichen Wahrheit" bringt, daß "alle Herrlichkeit des Menschen wie des Grases Blumen" ist. Wie es bei Brahms so schön heißt.
Auch der sympathische Korrepetitor Jan führt ab und zu verallgemeinernde, hochtrabend-geschwollene, innere Monologe: Hier "geht es um das Ewige, überlegt Jan" (als er sich in Köln den Dom anguckt), "uns dagegen geht es um die vergänglichsten Gefühle. Unsere Kunst ist die Kunst des richtigen Zeitpunkts. Wie oft tun, denken und sagen wir in Wirklichkeit das Falsche; oder wir tun das Richtige, aber zu früh, zu spät. Im Theater, denkt Jan auf dem Rückweg ins Hotel, wird Schicksal auf den Punkt gebracht, mit hoher Bedeutung und reinem Gefühl. Im Miterleben fremden Schicksals sind wir plötzlich von unserer privaten Zerrissenheit und Unzulänglichkeit befreit." Dies sind die schwächsten Stellen des Romans: Wenn allen Ernstes über das Richtige im Falschen doziert wird, wenn große, platte Töne gespuckt werden über Schicksal, Brunst und Leidenschaft in der Musik und die Autorin im Rausch des Schreibens plötzlich von dem Perlen der Tonketten und der Wonne gesträubten Haupthaars zu schwärmen beginnt.
Es gibt aber auch starke Momente. Der kräftige Schuß Selbstironie gehört dazu, der das outrierte Sprachgebaren immer wieder durchlöchert. Im übrigen handelt es sich, die Frage literarischer Qualität einmal beiseite gelassen, um ein amüsantes und lehrreiches Sachbuch über gewisse Aspekte des Opernbetriebs. Petra Morsbach hat selbst zehn Jahre lang als Dramaturgin an deutschen Stadttheatern gearbeitet, sie referiert nun ihre Erfahrungen mit Bienenfleiß und Gründlichkeit. Hier kann man en gros und en détail nachlesen, was man schon immer über Oper wissen wollte. Man erfährt endlich, was der Abendspielleiter am Abend tut, warum der "Liebestod" für die Isolden dieser Welt so schwer zu singen ist, was für fiese Witze sich Orchestermusiker unterdessen erzählen und von der geheimen Kunst, punktgenau zum Schlußton den Vorhang fallen zu lassen.
Petra Morsbach: "Opernroman". Opernroman. Eichborn Verlag, Frankfurt am Main 1998. 350 Seiten, geb., 49,50 DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main