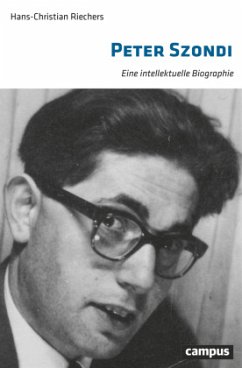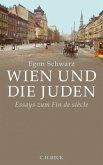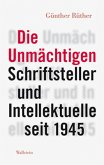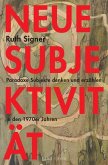Peter Szondi genießt in der Intellektuellengeschichte der Nachkriegszeit den Status einer Legende. Er ist einer der einflussreichsten Literaturwissenschaftler dieser Jahrzehnte und hat weit darüber hinaus gewirkt. Nicht nur seine bahnbrechenden Studien, sondern auch seine Freundschaft zu Theodor W. Adorno, Gershom Scholem, Paul Celan, Jacques Derrida und anderen, seine Geschichte als Shoah-Überlebender, sein Engagement im West-Berlin der Sechzigerjahre, seine intellektuelle Verve, sein dezentes und doch charismatisches Auftreten haben dazu beigetragen. Dieses Buch unternimmt den Versuch, Leben, Werk und intellektuelle Wirkung Szondis zusammenzuführen.Ausgewählt für die Shortlist des Opus Primum - Förderpreis der VolkswagenStiftung für die beste Nachwuchspublikation des Jahres 2020
»Riechers kann schreiben und hat vor allem ein Gespür für die historische Person und ihre Umgebungen. Dem Autor gelingt es vortrefflich, zu verdeutlichen, warum Szondi ein Phänomen war und eine Schlüsselfigur, um Kultur und Gesellschaft der Fünfziger- und Sechzigerjahre in der Bundesrepublik zu erhellen.« Jörg Später, Süddeutsche Zeitung, 04.06.2020 »Riechers' überzeugende Lesart, Szondis Werk als Engführung von Kritischer Theorie, Hermeneutik und Strukturalismus zu verstehen, verdeutlicht gerade vor dem Hintergrund der methodenpluralistisch zerfallenden Literaturwissenschaft der siebziger Jahre dessen Bedeutung für ein erkenntniskritisches Wissenschaftsverständnis weit über die Philologie hinaus.« Annette Wolf, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.06.2020 »In der 'intellektuellen Biographie' versucht Hans-Christian Riechers nun eine erklärende Verbindung herzustellen zwischen dem Menschen Peter Szondi und dessen literaturtheoretischen Texten. Das funktioniert und betont die tragische Engführung zwischen Leben und Werk.« Katrin Diehl, Jüdische Allgemeine, 26.07.2020 »Riechers Szondi-Biografie [...] sei zu lesen anempfohlen, weil sie in einer eleganten Wissenschaftsprosa ungelöste Probleme des vergangenen Jahrhunderts vergegenwärtigt und so ein wertvoller Beitrag auch zu aktuellen Debatten sein kann.« Jan Kuhlbrodt, Signaturen, 31.07.2020 »Riechers gut lesbare, nicht selten urteilsstarke Darstellung lohnt sich schließlich gerade für solche Leser, die sich für Entstehung und Potentiale literaturwissenschaftlicher Werke interessieren.« Mike Rottmann, Geschichte der Philologien, 57/58 2020