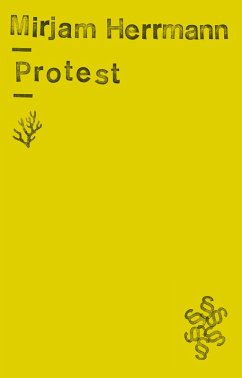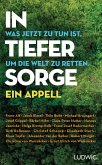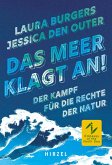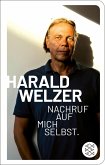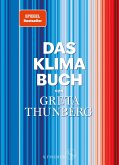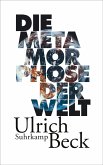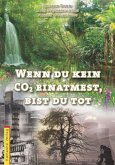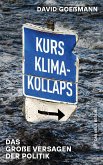Sie war Teil der IAA-Blockade in München und der spektakulären Barberini-Aktion in Potsdam, ihr juristisches Wissen setzt sie dazu ein, die Rechtshilfe für andere Aktivistinnen und Aktivisten aufzubauen. Dann wird Mirjam Herrmann selbst verurteilt, und beschließt, ihre Ersatzfreiheitsstrafe zu nutzen, um weitere Erfahrungen zu sammeln und Wissen weitergeben zu können: Wie fühlt es sich an, für die eigenen politischen Überzeugungen in den Knast zu gehen? Welche Formen von Solidarität lassen sich in der Haft erlernen? Und gibt es überhaupt noch einen anderen Umgang mit den Bedrohungen der sich entfaltenden Klimakrise, als im Hier und Jetzt ein anderes, ein verbundenes, ein unbedingtes Leben zu leben?
Als Angeklagte im Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ist Mirjam Herrmann Betroffene eines gefährlichen Präzedenzfalles in Zeiten, in denen Natur und Menschenrechte gleichermaßen bedroht sind. Warum sie trotzdem immer wieder die Entscheidung trifft, Widerstand zu leisten, erzählt sie in einem Essay, der die Frage nach Natur noch einmal ganz anders stellt: Sie ist unser aller Lebensraum, den es zu verteidigen, aber auch zu nähren gilt.
Als Angeklagte im Verfahren wegen Bildung einer kriminellen Vereinigung ist Mirjam Herrmann Betroffene eines gefährlichen Präzedenzfalles in Zeiten, in denen Natur und Menschenrechte gleichermaßen bedroht sind. Warum sie trotzdem immer wieder die Entscheidung trifft, Widerstand zu leisten, erzählt sie in einem Essay, der die Frage nach Natur noch einmal ganz anders stellt: Sie ist unser aller Lebensraum, den es zu verteidigen, aber auch zu nähren gilt.