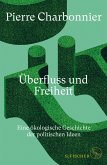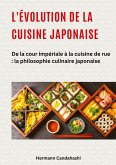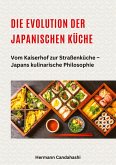In einer mitreißenden Mischung aus Reisebericht, Memoir und historischem Essay zeichnet der indische Autor die Anfänge des weltweiten Opiumhandels ab dem 19. Jahrhundert nach und macht deutlich, dass dessen Auswirkungen bis in die heutige Zeit reichen: von den mächtigsten Familien und prestigeträchtigsten Institutionen, deren Reichtum sich den Einnahmen aus dem Opiumgeschäft verdankt, bis hin zur amerikanischen Opioid-Epidemie und dem Oxycontin-Skandal.
Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege und Handelsrouten zahlreicher Menschen, auch seiner eigenen Vorfahren, im 19. Jahrhundert mit einer einzigen Pflanze verwoben waren: der Mohnblume. Das Britische Weltreich sicherte sich durch ihren Anbau in den indischen Kolonien die Handelsfähigkeit mit China, indische Bauern wurden über Jahrhunderte hinweg in prekärer Abhängigkeit gehalten, und die chinesische Bevölkerung wurde von einer unaufhaltsamen Drogenepidemie überspült. Währenddessen hofften internationale Handelsleute stets auf Reichtum durch die Beteiligung am Opiumhandel.
Während der jahrzehntelangen Archivrecherche für seine Ibis-Romantrilogie stellte Amitav Ghosh mit Erstaunen fest, dass die Lebenswege und Handelsrouten zahlreicher Menschen, auch seiner eigenen Vorfahren, im 19. Jahrhundert mit einer einzigen Pflanze verwoben waren: der Mohnblume. Das Britische Weltreich sicherte sich durch ihren Anbau in den indischen Kolonien die Handelsfähigkeit mit China, indische Bauern wurden über Jahrhunderte hinweg in prekärer Abhängigkeit gehalten, und die chinesische Bevölkerung wurde von einer unaufhaltsamen Drogenepidemie überspült. Währenddessen hofften internationale Handelsleute stets auf Reichtum durch die Beteiligung am Opiumhandel.
Perlentaucher-Notiz zur ZEIT-Rezension
Ein gut lesbares, berührendes, aber nicht immer schlüssiges Buch hat Amitav Ghosh über die kolonialen Dimensionen des Opiumhandels geschrieben, meint Rezensent Thomas E. Schmidt. Ghosh, der zum Thema auch bereits eine Romantrilogie vorgelegt hat, schreibt die Geschichte des Opiumhandels als eine koloniale Schuldgeschichte: Eindrücklich findet Schmidt vor allem jene Passagen, die zeigen, wie Großbritannien China auch mithilfe zweier Kriege zwingt, die Droge ins Land zu lassen und wie gleichzeitig indische Bauern den Rohstoff anbauen müssen. Außerdem zeigt Ghosh laut Schmidt auf, dass die USA ebenfalls von diesen Handelsströmen profitierte, was in seinen Augen dazu führt, dass sie nun selbst von einer Opioidkrise betroffen ist. Das ist der Punkt, ab dem Schmidt nicht mehr so recht mitgehen will: Für Ghosh hat das Opium Subjektstatus und es sorgt in gewisser Weise für historische Gerechtigkeit, wenn es nun auch Nordamerika heimsucht. Letzten Endes sei das eine Glaubensfrage, beziehungsweise ein zyklisches Weltbild, das Ghosh hier bediene, so der Kritiker. Auch allgemein stört ihn die postkoloniale Empörung des Buches, insgesamt aber liest er Ghoshs Ausführungen mit Gewinn.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH