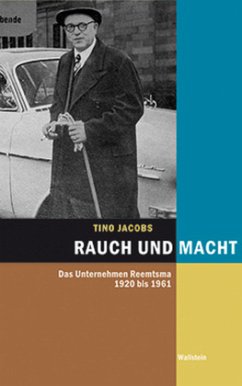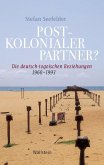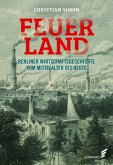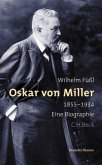Eine Fallstudie zur Festigung unternehmerischer Macht am Beispiel des größten deutschen Zigarettenherstellers im 20. Jahrhundert. Philipp Reemtsma (1893-1959) wurde schon zu Lebzeiten als »deutscher Zigarettenkönig« bezeichnet. Sein noch junges Unternehmen erreichte in den 1920er Jahren eine marktbeherrschende Stellung und lenkte bald die Geschicke der gesamten Branche. Wie waren der rasante Aufstieg und die Festigung dieser Stellung möglich? Der Autor analysiert erstmals die Machttechniken und Machtbeziehungen eines Unternehmens, das in beispielloser Weise auf das Handeln seiner Konkurrenten Einfluss nehmen konnte und auch die regulativen Rahmenbedingungen der Industrie mitgestaltete. Netzwerke und beste Kontakte zur Ministerialbürokratie gehörten ebenso dazu wie Zuwendungen für die NS-Elite in Millionenhöhe. Die von Reemtsma gepflegte paternalistische Haltung gegenüber der Konkurrenz fand ihre Fortsetzung in der Frühzeit der Bundesrepublik. Aus diesem Grund wird das Beispiel des größten deutschen Zigarettenherstellers zu einer Fallstudie moderner unternehmerischer Macht zwischen Kontinuität und Wandel, bei der in komplexer Weise zentrale Fäden deutscher Wirtschafts-, Sozial- und Kulturgeschichte des 20. Jahrhunderts zusammenlaufen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.