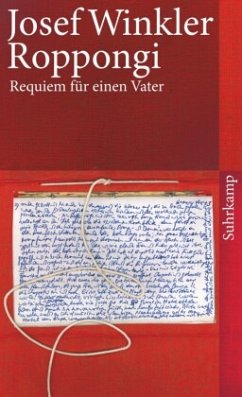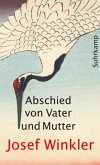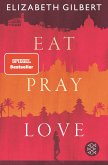'Als ich mich vor drei Jahren mit meiner Familie in Tokio aufhielt, wo wir im Stadtteil Roppongi wohnten, starb im Alter von 99 Jahren mein Vater, der mir ein Jahr vor seinem Tod in einem kurzen, aber dramatischen Telefonmonolog mitteilte, daß, wenn es soweit sei, ich nicht zu seinem Begräbnis kommen solle.'"In Roppongi erinnert sich der Georg-Büchner-Preisträger 2008 an seinen im biblischen Alter verstorbenen Vater. Es ist ein 'Gedenkmonument nachgetragener Liebe. Das 'Requiem für einen Vater' besitzt die Gnade der Leichtigkeit, hat jene Musikalität der Satzperioden und die von Ilse Aichinger an Winkler gerühmte 'fanatische Genauigkeit', die einen Schreibenden zum Dichter werden lassen. 'Ja, Vater, mach's gut', vernehmen wir da als Nachruf, 'ich wünsche dir eine gute Reise'." Ulrich Weinzierl in seiner Laudatio auf den Georg-Büchner-Preisträger
»Josef Winkler ist ein Grenzgänger, der schreibend seine Angst in Lust verwandelt und mit dem riskanten Balanceakt knapp am Abgrund langfristig zu solidem Gleichgewicht findet. Nicht Jenseitsverherrlichung betreibt er in Roppongi, sondern Selbstbefreiung im großen Stil. Dazu muss das Verdrängte allerdings in einem beunruhigenden Prozess, der auch den Leser keineswegs schont, immer wieder evoziert werden.« Süddeutsche Zeitung