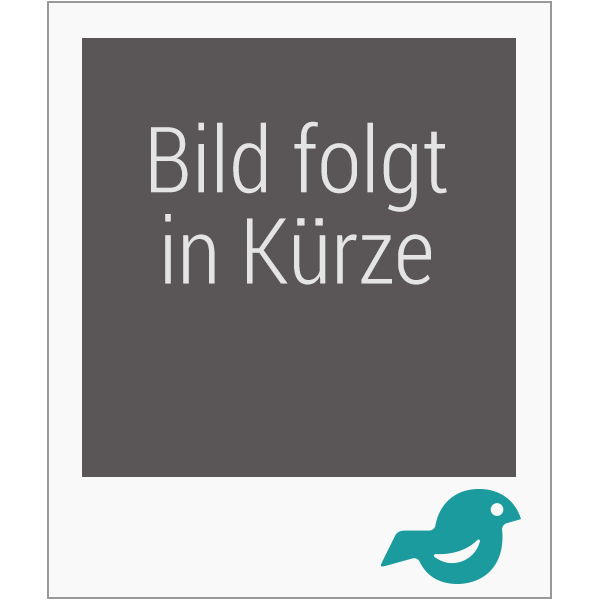KONZENTRATIONSLAGER. Georges Petit hat es nach fast fünfzig Jahren der Zurückhaltung über sich gebracht, über seine Haft in deutschen Gefängnissen und KZs zu schreiben. Obwohl es ihm seinerzeit gelungen war, trotz aller Schwierigkeiten rudimentäre Aufzeichnungen zu machen und sie in die Freiheit hinüberzuretten, ist es kein bloßer Erlebnisbericht. Es geht ihm darum, die seelische Situation, in der er und andere sich befunden hatten, darzustellen und uns, der Nachwelt, mitzuteilen, als eine der Facetten der condition humaine. Er tut das in einer ruhigen, man möchte sagen rücksichtsvollen Sprache. Petit war seit 1940 in der Résistance aktiv, wurde 1943 durch die Gestapo verhaftet, nach Aufenthalten in französischen Gefängnissen nach Buchenwald deportiert und 1944 zu Arbeitskommandos nach Langenstein-Zwieberge im heutigen Sachsen-Anhalt "überstellt", wie der furchtbare Ausdruck lautet. Im April 1945 - "Magdeburg und Halberstadt standen in Flammen" - wurde das Lager auf ziellose Märsche zwischen den heranrückenden amerikanischen und sowjetischen Fronten geschickt, wobei es Petit in letzter Minute gelang zu fliehen. Er wurde von einem deutschen Bauern versteckt und gelangte dann auf Fußmärschen in der Gegend von Wittenberg, Wörlitz und Dessau endlich auf die amerikanische Seite. In Frankreich war er als Psychologe tätig und arbeitete politisch in linken, nichtkommunistischen Organisationen. Natürlich schildert Petit die Brutalität oder gelegentliche Stumpfheit der deutschen und ausländischen SS-Bewacher, die zunehmende Entkräftung und Verwahrlosung der Häftlinge, am furchtbarsten den sinnlosen Todesmarsch zum Schluß, bei dem die aus Erschöpfung Umfallenden durch Genickschuß getötet wurden, manchmal sogar selber den Nacken hinhielten. Viel berichtet er über die russischen Gefangenen, bei denen die Zivilgefangenen von den Lagerverhältnissen insofern weniger beeindruckt waren, als sie sie an ihre eigenen erinnerten. Scham und Dankbarkeit erfüllt den deutschen Leser, wenn Petit erwähnt, daß beim Todeszug durch Dörfer von den Bewohnern Eimer mit Trinkwasser an den Straßenrand gestellt wurden und daß manche Frauen dabei weinten, ebenso davon, wie ihm nach seiner Flucht überall heimlich geholfen wurde. (Georges Petit: Rückkehr nach Langenstein. Erfahrungen eines Deportierten. Mit einem Vorwort von Jens Reich und einer Einführung von Claude Lefort. Aus dem Französischen übersetzt von Klaus-Dieter Bosse. Edition Memoria, Hürth bei Köln 2004. 228 Seiten, 19,50 [Euro].)
WOLFGANG SCHULLER
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Der mit "gü" zeichnende Rezensent hat in Georges Petits "Rückkehr nach Langenstein" ein beeindruckendes Beispiel für Erinnerungsliteratur entdeckt. Petit bietet, so der Rezensent, eine "nüchterne Innenansicht des KZ-Terrors ", eine kaltblütige Analyse der Dynamik der Entmenschlichung. Als politischer Häftling wurde Petit in Langenstein-Zwieberge, einem Außenkommando von Buchenwald, eingeliefert. Hier setzten die Insassen in Stollen im Berg V1- und V2-Raketen zusammen. Petit überlebte auch den "Todesmarsch" der Inhaftierten, den die SS beim Anrücken der Alliierten anordnete. Nach einem späten Besuch in dem Lager schrieb Petit, Publizist und Psychologe, seine Erinnerungen nieder. Ein besonderes Lob spendet der Rezensent dem "verdienstvollen Ein-Mann-Verlag" Edition Memoria.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH