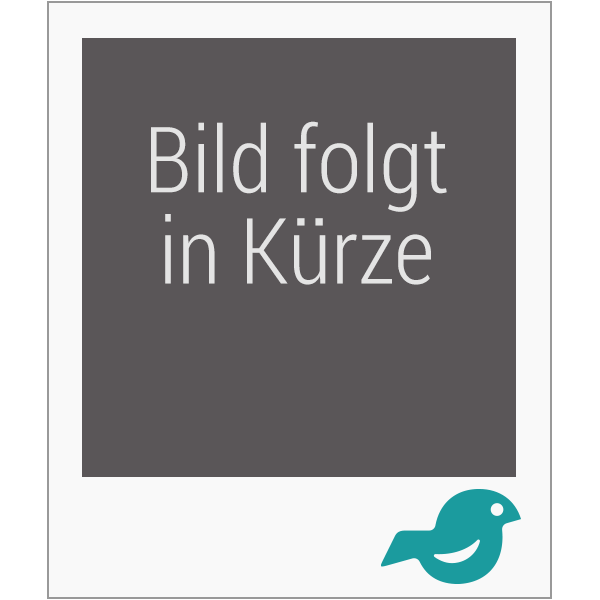"Auferstanden aus Ruinen - blüh im Glanze dieses Glückes ..."
Aus dem Vorwort des Herausgebers
Michael Kilian:
"Habent sua fata libelli: Die Idee eines "Erlebnisbandes zur Wieder-Errichtung des Landes Sachsen-Anhalt", die der Initiator in Magdeburg beim Gespräch mit einem Ministerialbeamten (der unter den Mitautoren ist) entwickelte, und die auf sofortige Zustimmung stieß, war während der letzten Jahre in Sachsen-Anhalt nach und nach in ihm gereift. Aber wie die Idee einer "oral history" der Wiederentstehung unseres Landes umsetzen?
Sie in die Tat umzusetzen erwies sich freilich wesentlich schwieriger als gedacht. Abgesehen von Fragen wie der Verlagssuche und der Finanzierung stieß der Plan bei seiner Umsetzung auf ganz unterschiedliche Resonanz unter den Angeschriebenen und Angesprochenen, etwa bei Geschäftsessen, im Kollegenkreis, bei Empfängen, ja beim Ansprechen auf der Straße: Die Empfindungsskala auf das Anliegen des Initiators reichte von spontaner Zustimmung und Ermunterung über Skepsis und Zögern, Zweifel und Bedenken bis hin zu unverhohlener Ablehnung. Zuweilen kam sich der Initiator vor, wie wenn er jemandem ein obszönes Angebot gemacht hätte. Oft stieß er auf Wände aus Desinteresse, vielleicht auch Unvermögen, zuweilen empfand er seine Bitte als Anmaßung und Zumutung. Sehr selten hatte er auch das subjektive Empfinden, der lästige "Wessi" zu sein, dem es nicht zukomme, an ostdeutsche Arkana zu rühren.
Mitmachen oder Nicht-Mitmachen geschahen aus unterschiedlichsten Gründen und Motiven heraus. Es gab sicher gute Gründe, nichts zu liefern, es konnte aber oft auch eine merkwürdige Scheu beobachtet werden, sich jetzt schon zu äußern, etwas offen zu legen und somit "öffentlich" zu machen - eine deutsche Eigenheit?
Einige Manuskripte kamen sehr schnell, manche nach längerer Zeit und auf Nachfrage, es gab spontane Nachmeldungen, von einigen kam das Zugesagte nie. Bei Vielen mag die eigene Arbeitsbelastung, vielleicht auch der noch fehlende Abstand vom Erlebten ein Motiv für Absage oder Nicht-Reaktion gewesen sein. Beides möchte und muß der Initiator respektieren. Möglicherweise kann man sich auf spätere Memoirenwerke freuen, Mitautor und Kollege Johannes Mehlig hat ein solches ja schon eindrucksvoll vorgelegt.
Bei manchen, die möglicherweise mitgemacht hätten, kam der Initiator nicht mehr dazu, sie anzusprechen und um Beiträge zu bitten. Manche konnten "auf den letzten Dreh" noch zusätzlich gewonnen werden. Um so dankbarer war der Initiator für freudig gegebene Zusagen und oft mit Enthusiasmus geschriebene Beiträge, oft von Persönlichkeiten, die im Getriebe ihrer Arbeit selbst völlig überlastet waren. Für sie hat sich der Einsatz gelohnt. Fazit: die Deutschen sind ein schwieriges Volk - wie schon der Landsmann des Initiators, Friedrich Hölderlin, so beklemmend festgestellt hat.
Was war diese Idee? Der Plan war, etwa zehn Jahre nach der Wiedervereinigung einen Kreis persönlich bekannter Menschen aus Halle, Magdeburg, Naumburg, Wittenberg um die ganz persönliche Geschichte ihres Umbruchs-Erlebnisses zu bitten - sozusagen angewandte Umbruchforschung, wie es die Soziologen mittlerweile nennen.
Die Auswahl der mitarbeitenden Persönlichkeiten geschah, weil persönlicher Bekanntschaft entsprungen, notgedrungen willkürlich, sie sollte aber jedenfalls aus den verschiedensten Funktionen in Verwaltung, Wissenschaft, Kommunen, Wirtschaft und Kunst kommen. Aus den Bereichen Wirtschaft und Kunst erwies sich das Gewinnen von Mitautoren allerdings als besonders schwierig - wohl deshalb, weil Professoren weder von Wirtschaft noch von Kunst etwas verstehen, und deshalb auch kaum Kontakt zu diesen Kreisen haben. (.....)
Der Initiator bekennt sich - als gebürtiger Schwabe und als österreichisch Verheirateter - zu diesem schwierigen, problembeladenen, oft ärgerlich und mutlos machenden Land, in dem er seit nunmehr zehn Jahren lebt, und das dennoch, von Naumburg bis Salzwedel, von Quedlinburg bis Stendal, deutsches Kernland, uralter Kulturboden, und das Land Luthers, Händels, von Guerickes, auch Bachs, Melanchthons (obgleich ursprünglich Schwabe), Nietzsches, Kurt Weills und vieler anderer großer Geister gewesen ist - und eben ein modernes deutsches Bundesland, Teil des lebendigen deutschen Föderalismus. Eines kann man dem Land Sachsen-Anhalt auf keinen Fall nachsagen: es sei langweilig!
Als solches kommt dem hier vorgelegten Band durchaus Dokumentarcharakter zu: eben nicht als Selbstdarstellung von "Wessis in Weimar", nicht als bloße Professoren-Selbstbetrachtung, sondern als Mischung aus Ost und West, aus Menschen möglichst zahlreicher Bereiche des öffentlichen Lebens. Von Menschen, die sich in dieser einmaligen geschichtlichen Phase Nachkriegsdeutschlands fanden, zusammenfanden und die, hoffentlich, künftig ohne trennende Ressentiments unser Land gemeinsam als deutsche Republik mitgestalten. (.....)
Die Inhalte konnten völlig frei gestaltet werden: als Bericht, persönliche Schilderung, nüchterner Abriß, Vortrags-Manuskript, ganz nach dem jeweiligem Temperament und nach dem Motto: "Greift nur hinein ins volle Menschenleben - und wo ihr hingreift, da ist's interessant ...", einzige formale Rahmensetzung war das zeitliche persönliche Erleben zwischen 1989 und 1992. (.....)" .
Aus dem Vorwort des Herausgebers
Michael Kilian:
"Habent sua fata libelli: Die Idee eines "Erlebnisbandes zur Wieder-Errichtung des Landes Sachsen-Anhalt", die der Initiator in Magdeburg beim Gespräch mit einem Ministerialbeamten (der unter den Mitautoren ist) entwickelte, und die auf sofortige Zustimmung stieß, war während der letzten Jahre in Sachsen-Anhalt nach und nach in ihm gereift. Aber wie die Idee einer "oral history" der Wiederentstehung unseres Landes umsetzen?
Sie in die Tat umzusetzen erwies sich freilich wesentlich schwieriger als gedacht. Abgesehen von Fragen wie der Verlagssuche und der Finanzierung stieß der Plan bei seiner Umsetzung auf ganz unterschiedliche Resonanz unter den Angeschriebenen und Angesprochenen, etwa bei Geschäftsessen, im Kollegenkreis, bei Empfängen, ja beim Ansprechen auf der Straße: Die Empfindungsskala auf das Anliegen des Initiators reichte von spontaner Zustimmung und Ermunterung über Skepsis und Zögern, Zweifel und Bedenken bis hin zu unverhohlener Ablehnung. Zuweilen kam sich der Initiator vor, wie wenn er jemandem ein obszönes Angebot gemacht hätte. Oft stieß er auf Wände aus Desinteresse, vielleicht auch Unvermögen, zuweilen empfand er seine Bitte als Anmaßung und Zumutung. Sehr selten hatte er auch das subjektive Empfinden, der lästige "Wessi" zu sein, dem es nicht zukomme, an ostdeutsche Arkana zu rühren.
Mitmachen oder Nicht-Mitmachen geschahen aus unterschiedlichsten Gründen und Motiven heraus. Es gab sicher gute Gründe, nichts zu liefern, es konnte aber oft auch eine merkwürdige Scheu beobachtet werden, sich jetzt schon zu äußern, etwas offen zu legen und somit "öffentlich" zu machen - eine deutsche Eigenheit?
Einige Manuskripte kamen sehr schnell, manche nach längerer Zeit und auf Nachfrage, es gab spontane Nachmeldungen, von einigen kam das Zugesagte nie. Bei Vielen mag die eigene Arbeitsbelastung, vielleicht auch der noch fehlende Abstand vom Erlebten ein Motiv für Absage oder Nicht-Reaktion gewesen sein. Beides möchte und muß der Initiator respektieren. Möglicherweise kann man sich auf spätere Memoirenwerke freuen, Mitautor und Kollege Johannes Mehlig hat ein solches ja schon eindrucksvoll vorgelegt.
Bei manchen, die möglicherweise mitgemacht hätten, kam der Initiator nicht mehr dazu, sie anzusprechen und um Beiträge zu bitten. Manche konnten "auf den letzten Dreh" noch zusätzlich gewonnen werden. Um so dankbarer war der Initiator für freudig gegebene Zusagen und oft mit Enthusiasmus geschriebene Beiträge, oft von Persönlichkeiten, die im Getriebe ihrer Arbeit selbst völlig überlastet waren. Für sie hat sich der Einsatz gelohnt. Fazit: die Deutschen sind ein schwieriges Volk - wie schon der Landsmann des Initiators, Friedrich Hölderlin, so beklemmend festgestellt hat.
Was war diese Idee? Der Plan war, etwa zehn Jahre nach der Wiedervereinigung einen Kreis persönlich bekannter Menschen aus Halle, Magdeburg, Naumburg, Wittenberg um die ganz persönliche Geschichte ihres Umbruchs-Erlebnisses zu bitten - sozusagen angewandte Umbruchforschung, wie es die Soziologen mittlerweile nennen.
Die Auswahl der mitarbeitenden Persönlichkeiten geschah, weil persönlicher Bekanntschaft entsprungen, notgedrungen willkürlich, sie sollte aber jedenfalls aus den verschiedensten Funktionen in Verwaltung, Wissenschaft, Kommunen, Wirtschaft und Kunst kommen. Aus den Bereichen Wirtschaft und Kunst erwies sich das Gewinnen von Mitautoren allerdings als besonders schwierig - wohl deshalb, weil Professoren weder von Wirtschaft noch von Kunst etwas verstehen, und deshalb auch kaum Kontakt zu diesen Kreisen haben. (.....)
Der Initiator bekennt sich - als gebürtiger Schwabe und als österreichisch Verheirateter - zu diesem schwierigen, problembeladenen, oft ärgerlich und mutlos machenden Land, in dem er seit nunmehr zehn Jahren lebt, und das dennoch, von Naumburg bis Salzwedel, von Quedlinburg bis Stendal, deutsches Kernland, uralter Kulturboden, und das Land Luthers, Händels, von Guerickes, auch Bachs, Melanchthons (obgleich ursprünglich Schwabe), Nietzsches, Kurt Weills und vieler anderer großer Geister gewesen ist - und eben ein modernes deutsches Bundesland, Teil des lebendigen deutschen Föderalismus. Eines kann man dem Land Sachsen-Anhalt auf keinen Fall nachsagen: es sei langweilig!
Als solches kommt dem hier vorgelegten Band durchaus Dokumentarcharakter zu: eben nicht als Selbstdarstellung von "Wessis in Weimar", nicht als bloße Professoren-Selbstbetrachtung, sondern als Mischung aus Ost und West, aus Menschen möglichst zahlreicher Bereiche des öffentlichen Lebens. Von Menschen, die sich in dieser einmaligen geschichtlichen Phase Nachkriegsdeutschlands fanden, zusammenfanden und die, hoffentlich, künftig ohne trennende Ressentiments unser Land gemeinsam als deutsche Republik mitgestalten. (.....)
Die Inhalte konnten völlig frei gestaltet werden: als Bericht, persönliche Schilderung, nüchterner Abriß, Vortrags-Manuskript, ganz nach dem jeweiligem Temperament und nach dem Motto: "Greift nur hinein ins volle Menschenleben - und wo ihr hingreift, da ist's interessant ...", einzige formale Rahmensetzung war das zeitliche persönliche Erleben zwischen 1989 und 1992. (.....)" .