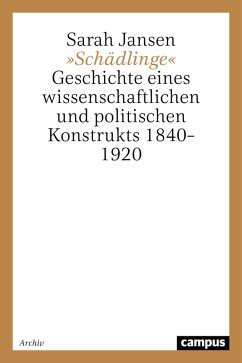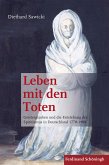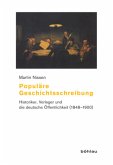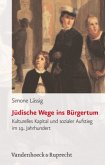Sarah Jansen rekonstruiert die Herstellung eines wissenschaftlichen Gegenstandes und die damit verbundenen Institutionen und Praktiken. Am historischen Fall der angewandten Entomologie, der Wissenschaft von der Bekämpfung »schädlicher« Insekten, entwickelt sie eine Theorie und Methodik, womit der »Schädling« als Wirkung und nicht als Ursache der »Schädlingsbekämpfung« analysiert wird. Darüber hinaus zeigt die Autorin eindrücklich, wie ein biologisches Fach eigenen politischen Einfluß gewann, indem es sich mit gesellschaftlichen Bedeutungsfeldern wie »Reinheit«, »Degeneration«, »Rasse« und »Vernichtung« in Beziehung setzte und Praktiken der chemischen Kriegsführung integrierte. Damit trägt das Buch zu zwei aktuellen Diskussionen bei: zur historisch-epistemologischen Analyse von Naturwissenschaften und zur Analyse der Voraussetzungen für den Holocaust.Unveränderter Nachdruck der Ausgabe von 2003
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno