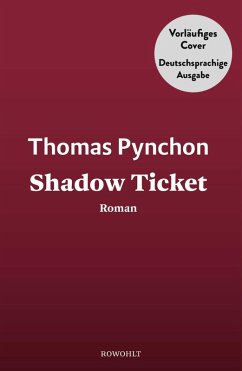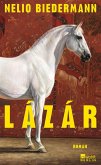Milwaukee, 1932: Amerika steckt in der Großen Depression, die Aufhebung der Prohibition steht kurz bevor, Al Capone sitzt im Knast. Hicks McTaggart, Privatdetektiv, nimmt einen Routinejob an: Er soll die ausgebüxte Erbin eines Käse-Fabrikanten ausfindig machen und nach Hause bringen. Doch unversehens findet er sich auf einem Ozeandampfer wieder und landet schließlich fern jedem Seehafen in Ungarn, wo eine Sprache wie von einem anderen Stern gesprochen wird und es genug Backwaren gibt, um einen Detektiv bis ans Lebensende zu versorgen, aber jede Spur von der flüchtigen Erbin fehlt. Als Hicks sie endlich gefunden hat, steckt er bis zum Hals in Verwicklungen mit Nazis, sowjetischen Agenten, britischen Gegenspionen, Swing-Musikern und Liebhabern paranormaler Praktiken. Der einzige Hoffnungsschimmer am Horizont: Es kündigt sich die große Zeit der Big Bands an, und zufällig ist Hicks ein ziemlich guter Tänzer. Ob das ausreicht, um im Lindy-Hop-Schritt nach Milwaukee und in die normale Welt zurückzukehren, die es vielleicht gar nicht mehr gibt, steht auf einem anderen Blatt.
Mit Freuden verirrt sich Rezensent Thomas David in diesem neuen und womöglich letzten Roman Thomas Pynchons. Diesmal heften sich die Leser an die Fersen des Privatdetektivs Hicks McTaggart, die Handlung setzt im Milwaukee des Jahres 1932 an, die Hauptfigur soll eine verschwundene Industriellentochter aufspüren. Das behauptet jedenfalls, präzisiert David, der Klappentext, die vermeintlich geläufige Hard-Boiled-Erzählung, die da angedeutet wird, gestaltet sich im Buch selbst aber natürlich deutlich verwirrender und barocker. Wie vom Blitz getroffen irrt McTaggart durch die Welt des Romans, beschreibt David, begegnet dabei unter anderem einem "Al Capone des Käses" und schifft sich schließlich gen Ungarn ein, wo der Roman sich schließlich in eine Art karnevaleske Faschismusreflexion verwandelt, die als eine Art historisches Prequel zu Pynchons "Die Enden der Parabel" funktioniert, erkennt der Kritiker. Wie der Autor überhaupt zahlreiche Spuren in Richtung seines eigenen Werks legt - erfahrene Pynchon-Exegeten werden ihre helle Freude haben an dem Buch, ist sich David sicher. Auch er hat Spaß an den vielen wirren Fährten, die dieser Text versammelt und zählt einige der skurrilen Begebenheiten und Figuren des Buches auf, von explodierenden Lastwagen über ein ungarisches Mardi Gras bis zu Drehtüren mit Umkehrpunkt, die die Reihenfolge der sie Betretenden durcheinander bringen. Was den Rezensent jedoch am tiefsten beeindruckt, ist, wie es Pynchon gelingt, hinter seinem metafiktionalen Spiegelkabinett am Ende doch eine finstere Realgeschichte greifbar werden zu lassen.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH