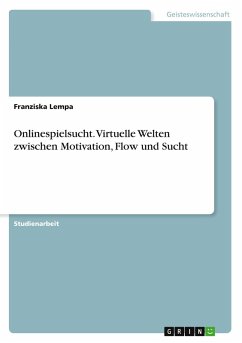Sigusch gewährt mit dieser Sammlung seiner besten verstreut publizierten Essays Einblicke in die Fragen, mit denen sich die Sexualwissenschaft befasst. Können Säuglinge einen Orgasmus haben? Wie sieht heute die Jugendsexualität aus? Ist der klitoridale Orgasmus reifer als der vaginale? Wie ist Aids vergesellschaftet worden? Welche Erkenntnisse haben sexuelle Experimente im Labor erbracht? Was ist natürlich am Sexuellen? Ist die Homosexualität angeboren oder erworben? Wie funktioniert die Paartherapie? Kann die Sexualität definiert werden? Was heißt Geschlechtswechsel? Besonders reizvoll an diesem Buch ist die Spannung, die dadurch erzeugt wird, dass Sigusch neben leicht lesbaren Traktaten, wie 'Von der Kostbarkeit Liebe', theoretisch anspruchsvolle Beiträge, wie den 'Satz vom ausgeschlossenen Geschlecht', präsentiert. Ein lustvolles Lesevergnügen.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensent Michael Adrian unterscheidet zwischen dem Sexualwissenschaftler und dem Kulturkritiker Volkmar Sigusch. Der eine zeichne ein durchaus "ambivalentes und komplexes" Bild von den unnatürlichen Veränderungen, denen Sexualität seit den sechziger Jahren unterworfen ist. Weniger differenziert dagegen agiere der Kulturkritiker Sigusch, der sich mit pessimistischen Grundbegriffen wie "Verstofflichung", sosehr sie beispielsweise biotechnologische Denkweisen angemessen seien, eine neugierig lebendige Analyse versperre. Wer den modernen Menschen "adornitisch" nur noch als lebenden Toten begreife, so Adrian, schaue nicht so genau hin, "was die Individuen da treiben". Historisch beschreibe Sigusch eine "Umstellung" der Sexualitätsvorstellung vom Paradigma der Befreiung hin zu einer Infragestellung der Geschlechterrollen. Nicht mehr Lust, sondern Angst sei das Charakteristikum der "neosexuellen Revolution". Angst um die eigene Identität und ob der öffentlichen Diskurse zu Kinderschändern, Vergewaltigern etc. Beim Thema Pädophilie folgt der Rezensent durchaus Siguschs Polemik gegen "die allgemeine Hysterie" wenn dieser betont, dass Pädophile ihren Fetisch, das Kind, ernster nehmen als Fernsehapparate, doch das Argument selbst sei ein "abgestandenes Klischee". Hier blockiere wieder einmal der Kulturkritiker weiterführende Fragen des Sexualwissenschaftlers.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH