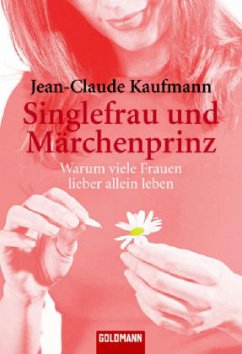Warum leben so viele Frauen allein?, fragt der französische Soziologe Jean-Claude Kaufmann. Er studierte Hunderte von Leserbriefen, die die Frauenzeitschrift Marie-Claire zu diesem Thema erreichten, zog statistische Erhebungen und wissenschaftliche Abhandlungen zu Rate. Den vielfältigen Ursachen, Bedingungen und Möglichkeiten fürs Single-Dasein spürt er in dieser klugen, verständlich geschriebenen Untersuchung über das Alleinleben nach.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensentin Kathrin Kommerell zeigt sich recht angetan von Jean-Claude Kaufmanns Studie über das Leben der Single-Frauen. Wie Kommerell ausführt, erforscht der französische Soziologe im Auftrag der EU anhand von 150 Briefen allein stehender Frauen zwischen 18 und 50 Jahren die Lebenswelten der Single-Frau. Von besonderem Interesse ist für Kaufmann das "zweigeteilte Leben" zwischen Freiheit und Verlorenheit, berichtet Kommerell. Sie lobt den Soziologen Kaufmann, der eher in der wissenschaftlichen Empirie und der analytischen Verallgemeinerung zu Hause ist, dafür, dass er immer wieder zum "Erzählen der Single-Leben" zurück findet. Besonders die Briefe, in denen die Frauen ihre Geschichte "mit enormer Selbstreflexion" erzählen, haben es Kommerell angetan: sie "sprechen Bände". Für Kaufmann ist das Phänomen der Singel-Frau Teil des "Vorwärtsdrängens einer Gesellschaft, deren Antrieb Individualisierung heißt", findet Kommerell. Die gesellschaftlichen Folgen des Singel-Daseins, das für Kommerell auch ein Angriff auf die Ehe oder zumindest auf hergebrachte Geschlechterrollen ist, kommen ihrer Meinung nach bei Kaufman leider etwas zu kurz.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH