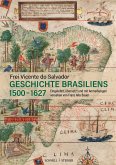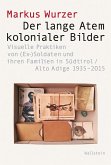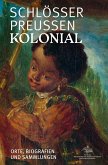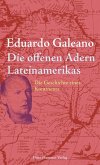In den blutigen Dekolonisierungskriegen kämpften nicht nur Soldaten aus Europa in der portugiesischen Armee. Erstmals wird die Geschichte der afrikanischen Soldaten im Dienste Portugals rekonstruiert.In der zweiten Hälfte des 20. Jahrhunderts zeichnete die Dekolonisation die politische Weltkarte neu. Nur Portugal widersetze sich dieser Entwicklung und versuchte als letzter europäischer Staat an großflächigen Kolonien festzuhalten. Jahrelang führten das konservativ-autoritäre Regime in Lissabon und die Unabhängigkeitsbewegungen in Angola, Mosambik und Guinea-Bissau blutige Guerrillakriege. Dafür schickte die portugiesische Regierung nicht nur zahlreiche Soldaten aus Europa nach Afrika sondern rekrutierte auch im großen Stil Kämpfer in den Kolonien selbst. In der Erinnerungskultur und der Forschung wurde diese Gruppe der afrikanischen Soldaten, die auf portugiesischer Seite kämpften, bisher wenig beachtet. Nils Schliehe geht ihrer Geschichte nach und zeigt anhand von Archivquellen und Zeitzeugeninterviews, dass die afrikanischen Soldaten in den Dekolonisierungskriegen eine bedeutende Rolle spielten und etwa die Hälfte der portugiesischen Sicherheitskräfte in den Kolonien bildeten. Schliehe untersucht wie die afrikanischen Soldaten rekrutiert und eingesetzt wurden, und betrachtet das Verhältnis zu ihren europäischen Kameraden und die eigene Wahrnehmung. Abschließend nimmt er auch das Schicksal der afrikanischen Soldaten nach der Unabhängigkeit in den Blick.
Bitte wählen Sie Ihr Anliegen aus.
Rechnungen
Retourenschein anfordern
Bestellstatus
Storno