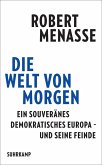Wie gelang in England, den USA oder in Frankreich einst der Systemwechsel zur parlamentarischen Demokratie? Welche Gründe führten ihre Befürworter an? Und warum vollzog sich dieser Wandel in Deutschland erst relativ spät?
Um diese Fragen zu beantworten, befasst Philipp Lepenies sich mit Wegmarken der Demokratiegeschichte. Zu seinen Protagonisten zählen die englischen Levellers, der Amerikaner James Madison und der Franzose Abbé Sieyès, Georg Forster in Mainz, Friedrich Jucho in Frankfurt und Hugo Preuß in Weimar. Aus dem Wissen um das Werden der Demokratie lassen sich Erkenntnisse gewinnen, die helfen, sich gegen ihr drohendes Vergehen zu stemmen - in einer Zeit, in der sich der Souverän immer häufiger gegen das System entscheidet, das ihm die höchste politische Macht einräumt.
Um diese Fragen zu beantworten, befasst Philipp Lepenies sich mit Wegmarken der Demokratiegeschichte. Zu seinen Protagonisten zählen die englischen Levellers, der Amerikaner James Madison und der Franzose Abbé Sieyès, Georg Forster in Mainz, Friedrich Jucho in Frankfurt und Hugo Preuß in Weimar. Aus dem Wissen um das Werden der Demokratie lassen sich Erkenntnisse gewinnen, die helfen, sich gegen ihr drohendes Vergehen zu stemmen - in einer Zeit, in der sich der Souverän immer häufiger gegen das System entscheidet, das ihm die höchste politische Macht einräumt.
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Insgesamt gern lässt sich Rezensentin Thekla Dannenberg von Philipp Lepenies erklären, wie Demokratien in verschiedenen Ländern historisch entstanden sind. Wobei der Ausgangspunkt, den der Wirtschafts- und Politikwissenschaftler Lepenies wählt, laut Dannenberg ein anderer ist, nämlich das Erschrecken darüber, wie sehr die Demokratie in der Gegenwart in Misskredit geraten ist, oft regelrecht verachtet wird. Dannenberg geht auf einzelne Beispiele Lepenies' ein, der zum Beispiel darstellt, wie in England im 17. Jahrhundert radikale Puritaner für Bürgerrechte eintraten, oder wie während der Französischen Revolution der Abbé Sieyès die Adelsprivilegien kritisierte, auch die gescheiterten Revolutionen in Deutschland werden behandelt. Durchaus ungewöhnliche Perspektiven wählt Lepenies im Zuge dieser Darstellungen, beschreibt Dannenberg, derzufolge das Buch sich manchmal außerdem etwas altmodisch liest. Insgesamt jedoch kann die Rezensentin einiges mit dem Gelesenen anfangen, besonders auch mit Lepenies' Fazit, das darauf hinaus läuft, dass Demokratie einerseits dem in ihr inhärenten Versprechen eines besseren Lebens treu bleiben muss und andererseits der aktiven Einübung bedarf.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Was der Ökonom und Politikwissenschaftler Philipp Lepenies [in Souveräne Entscheidungen] berichtet, ist ... lesenswert. ... Denn, so die These: Wenn wir um das 'Werden' unserer Demokratie Bescheid wissen, können wir Erkenntnisse gewinnen, um etwas gegen deren 'Vergehen' zu tun.« Thomas Hödlmoser Salzburger Nachrichten 20250705