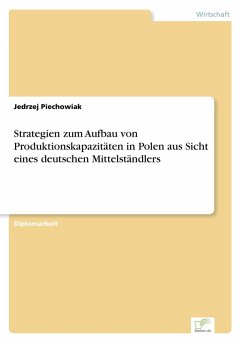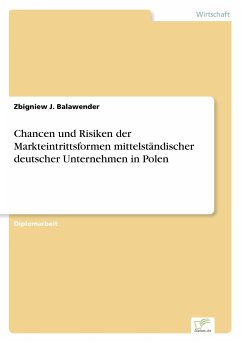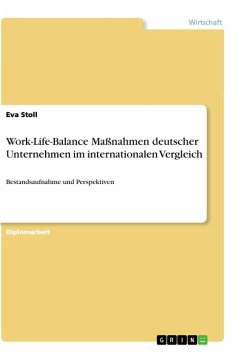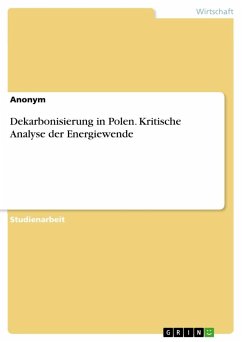Diplomarbeit aus dem Jahr 2003 im Fachbereich BWL - Handel und Distribution, Note: 2,0, Friedrich-Schiller-Universität Jena (Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät), Sprache: Deutsch, Abstract: Inhaltsangabe:Einleitung: Wettbewerb im Supermarkt der Standorte Osteuropäische EU-Beitrittsländer werben mit Erfolg um deutschen Mittelstand (Höhne 2003), Mittelständler versäumen Chancen in Polen und Tschechien (Liertz 2003), Die EU-Osterweiterung bietet insbesondere dem Mittelstand neue Chancen (Basdorf 2003), Neue Chancen durch EU-Beitritt (Schrick-Hildebrandt 2003), Autoindustrie zieht es ostwärts (Bertram/Herz/Jocham 2002),
Diese Nachrichtenflut bricht in immer kürzeren Abständen über die deutsche Presselandschaft herein und weckt in den meisten Fällen Ängste innerhalb der mittelständischen Unternehmer- und Arbeitnehmerschaft. Besonders vor dem Hintergrund der außerordentlichen gewerkschaftlichen Konflikte des Jahres 2003 (s. 35-Stundenwoche) erlebt die gesamte Debatte eine Neuauflage in Verbindung mit der Diskussion um den Produktionsstandort Deutschland.
Manager der Großkonzerne und des Mittelstandes manifestieren offenkundig ihre Bereitschaft deutsche Produktionskapazitäten nach Mittel- und Osteuropa zu verlagern. Die Politik sucht parallel nach Handlungsalternativen, um im globalen Wettbewerb der Standorte bestehen zu können. Doch handelt es sich hierbei überhaupt um einen reinen Standortwettbewerb innerhalb Europas? Zu welchem Ergebnis kommt man, wenn Europa als Ganzes in den Kontext des globalen Standortwettbewerbs gestellt wird? Bedeutet die EU-Osterweiterung wirklich eine Bedrohung oder gar eine neue Chance für den deutschen Mittelstand? Die oft medial, gewerkschaftlich und politisch implizierte Kausalität zwischen der EU-Osterweiterung und dem Verlust von Arbeitsplätzen erscheint für Laien überaus plausibel.
Diese Arbeit ist jedoch keine Partialanalyse, wie sie oft in täglichen Debatten zu finden ist. Vielmehr trägt sie dazu bei, die Problematik in ihrer Gesamtheit zu betrachten und mögliche Entwicklungspfade für eine langfristige Sicherung von mittelständischen Erfolgspotentialen abzuleiten.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
InhaltsverzeichnisI
AbbildungsverzeichnisIV
TabellenverzeichnisV
AbkürzungsverzeichnisVI
1.EINLEITUNG1
1.1Problemstellung und Exkurs1
1.2Literaturlage2
1.3Zielsetzung und wissenschaftstheoretische Einordnung der Arbeit3
1.4Aufbau der Arbeit4
2.DER DEUTSCHE MITTELSTAND UND DIE EU-ERWEITERUNG5
2.1Abgrenzung des Untersuchungsobjektes5
2.1.1Definition des deutschen Mittelstandes5
2.1.2Produktionstechnische Abgrenzungsmerkmale des Untersuchungsobjektes6
2.1.2.1Größe nach Umsatz und Mitarbeiter6
2.1.2.2kapitalintensive vs. arbeitsintensive Produktion7
2.1.2.3Branchen und geographische Cluster des Mittelstandes8
2.1.2.4Güterarten der Produktion12
2.1.2.5Mittelserien- bis Prozessfertigung (Break-Even der Transportkosten)13
2.1.3Grad der Internationalisierung des deutschen Mittelstandes14
2.1.4Knappe Ressourcen Im Spannungsfeld zwischen Strategie und Alltag15
2.2Gründe für die Internationalisierung deutscher Mittelständler nach MOE16
2.2.1Pull-Effekte (Internationalisierungsanreize)16
2.2.2Push-Effekte (Internationalisierungszwänge)18
2.3Besondere Ausgangslage durch die EU Osterweiterung19
2.4Zwischenergebnis20
3.RAHMENBEDINGUNGEN - PRODUKTIONSSTANDORT POLEN21
3.1Politische und rechtliche Rahmenbedingungen21
3.1.1Zur Stabilität der politischen Lage in Polen21
3.1.1.1Demokratisierung und der Reformprozess21
3.1.1.2Risikofaktor Landwirtschaft und der indirekte Einfluss auf die Wirtschaftspolitik22
3.1.2Rechtliche Aspekte22
3.1.2.1Grundzüge des Gesellschaftsrechts24
3.1.2.2Grundzüge der p...
Diese Nachrichtenflut bricht in immer kürzeren Abständen über die deutsche Presselandschaft herein und weckt in den meisten Fällen Ängste innerhalb der mittelständischen Unternehmer- und Arbeitnehmerschaft. Besonders vor dem Hintergrund der außerordentlichen gewerkschaftlichen Konflikte des Jahres 2003 (s. 35-Stundenwoche) erlebt die gesamte Debatte eine Neuauflage in Verbindung mit der Diskussion um den Produktionsstandort Deutschland.
Manager der Großkonzerne und des Mittelstandes manifestieren offenkundig ihre Bereitschaft deutsche Produktionskapazitäten nach Mittel- und Osteuropa zu verlagern. Die Politik sucht parallel nach Handlungsalternativen, um im globalen Wettbewerb der Standorte bestehen zu können. Doch handelt es sich hierbei überhaupt um einen reinen Standortwettbewerb innerhalb Europas? Zu welchem Ergebnis kommt man, wenn Europa als Ganzes in den Kontext des globalen Standortwettbewerbs gestellt wird? Bedeutet die EU-Osterweiterung wirklich eine Bedrohung oder gar eine neue Chance für den deutschen Mittelstand? Die oft medial, gewerkschaftlich und politisch implizierte Kausalität zwischen der EU-Osterweiterung und dem Verlust von Arbeitsplätzen erscheint für Laien überaus plausibel.
Diese Arbeit ist jedoch keine Partialanalyse, wie sie oft in täglichen Debatten zu finden ist. Vielmehr trägt sie dazu bei, die Problematik in ihrer Gesamtheit zu betrachten und mögliche Entwicklungspfade für eine langfristige Sicherung von mittelständischen Erfolgspotentialen abzuleiten.
Inhaltsverzeichnis:Inhaltsverzeichnis:
InhaltsverzeichnisI
AbbildungsverzeichnisIV
TabellenverzeichnisV
AbkürzungsverzeichnisVI
1.EINLEITUNG1
1.1Problemstellung und Exkurs1
1.2Literaturlage2
1.3Zielsetzung und wissenschaftstheoretische Einordnung der Arbeit3
1.4Aufbau der Arbeit4
2.DER DEUTSCHE MITTELSTAND UND DIE EU-ERWEITERUNG5
2.1Abgrenzung des Untersuchungsobjektes5
2.1.1Definition des deutschen Mittelstandes5
2.1.2Produktionstechnische Abgrenzungsmerkmale des Untersuchungsobjektes6
2.1.2.1Größe nach Umsatz und Mitarbeiter6
2.1.2.2kapitalintensive vs. arbeitsintensive Produktion7
2.1.2.3Branchen und geographische Cluster des Mittelstandes8
2.1.2.4Güterarten der Produktion12
2.1.2.5Mittelserien- bis Prozessfertigung (Break-Even der Transportkosten)13
2.1.3Grad der Internationalisierung des deutschen Mittelstandes14
2.1.4Knappe Ressourcen Im Spannungsfeld zwischen Strategie und Alltag15
2.2Gründe für die Internationalisierung deutscher Mittelständler nach MOE16
2.2.1Pull-Effekte (Internationalisierungsanreize)16
2.2.2Push-Effekte (Internationalisierungszwänge)18
2.3Besondere Ausgangslage durch die EU Osterweiterung19
2.4Zwischenergebnis20
3.RAHMENBEDINGUNGEN - PRODUKTIONSSTANDORT POLEN21
3.1Politische und rechtliche Rahmenbedingungen21
3.1.1Zur Stabilität der politischen Lage in Polen21
3.1.1.1Demokratisierung und der Reformprozess21
3.1.1.2Risikofaktor Landwirtschaft und der indirekte Einfluss auf die Wirtschaftspolitik22
3.1.2Rechtliche Aspekte22
3.1.2.1Grundzüge des Gesellschaftsrechts24
3.1.2.2Grundzüge der p...