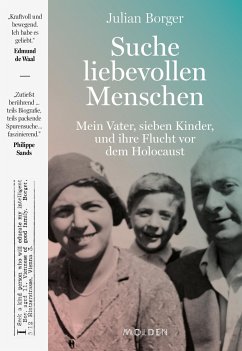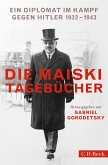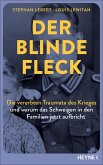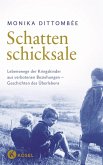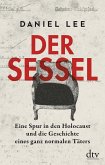Wien, 1938. Verzweifelt versuchen jüdische Eltern, ihre Kinder vor den Nazis in Sicherheit zu bringen. In ihrer Not schalten sie Kleinanzeigen im »Manchester Guardian«, in denen sie ihre eigenen Kinder ausschreiben, um ihnen ein Überleben in der Fremde zu sichern - obwohl sie wissen, dass sie sich nie wiedersehen werden. Jahrzehnte später stößt der Journalist Julian Borger auf eine dieser Anzeigen und erkennt den Namen eines der Kinder: Robert Borger. Sein Vater. Es ist der Beginn einer Recherche, die Julian Borger mitten hinein führt in ein dunkles Familiengeheimnis. Und Anlass für ihn ist, die Spuren von sieben weiteren Kindern zu verfolgen, deren Schicksalsreise von Wien aus ins Exil nach Shanghai, in die Arme von niederländischen Schmugglern, an die Seite französischer Widerstandskämpfer - oder ins KZ Auschwitz führte.
"Eine kraftvolle, wunderbar erzählte, ergreifende Erzählung. Ich habe sie geliebt." Edmund de Waal, "Der Hase mit den Bernsteinaugen" "Eine zutiefst bewegende Geschichte, teils Biografie, teils packende Spurensuche. Ein berührendes und faszinierendes Buch, das in einer Zeit wie der unseren, wichtiger denn je ist. Ich konnte es nicht weglegen." Philippe Sands, "Die Rattenlinie" "Nicht nur unglaublich gut recherchiert, sondern auch liebevoll, aufrüttelnd und bewegend." Jonathan Freedland, "The Escape Artist: The Man Who Broke Out of Auschwitz to Warn the World"
Perlentaucher-Notiz zur Dlf-Rezension
Bei der Lektüre dieser rekonstruierten Fluchtgeschichte entdeckt Rezensent Ralph Gerstenberg "ein bislang weitgehend unerzähltes Kapitel" des Nationalsozialismus. Julian Borger erzählt davon, wie Eltern jüdischer Kinder in englischen Zeitungsanzeigen Pflegefamilien in Großbritannien suchten. Eines dieser Kinder war sein Vater Robert Borger, der es nach Wales schaffte und sich später in Großbritannien ein neues Leben aufbaute. Borger habe ein "persönliches und bewegendes Buch" geschrieben, lobt Gerstenberg, das aber auch die Erfahrung der Flucht dokumentiere: Zwar hätten sich die Briten solidarisch mit den Opfern des Hitler-Regimes gezeigt, doch seien die Flüchtlinge im Exil oft in einer prekären Situation gewesen. So auch die Eltern von Robert Borger, die ihren Sohn nach dessen ebenfalls geglückter Flucht wegen ihres Dienstbotenvisums nicht aufnehmen konnten. Später nimmt sich Robert das Leben, und der Sohn Julian begreift, dass hinter dieser Entscheidung das unüberwindbare Trauma der Flucht steht, fasst der Rezensent zusammen. Gerstenberg spürt dem im Buch allgegenwärtigen Leid nach und schließlich drängen sich ihm Parallelen zu den Schicksalen heutiger Migranten auf.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH