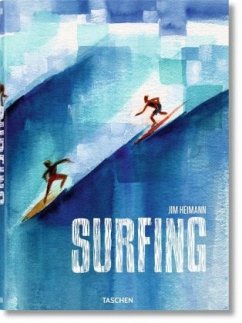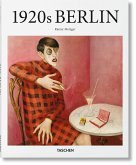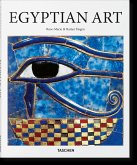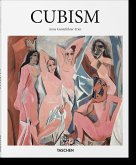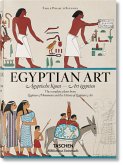Aerial, Twinfin und Newschool - heutiger Surferjargon lässt kaum vermuten, dass die neuzeitliche Geschichte des Surfens mit Captain Cooks Südsee-Expedition 1778 begann. Von Polynesien aus hat das Surfen die Welt erobert und mittlerweile viele Bereiche unserer Kultur durchdrungen - Mode, Pop, Sport, Kino und Fotografie.
Was Anfang des letzten Jahrhunderts noch ein exotisches Vergnügen weniger Abenteurer war und später als Subkultur die Mythologie Kaliforniens prägte, ist im Mainstream angekommen und mit seinen rund 20 Millionen Aktiven weltweit und ungezählten Fans zur festen Größe der Freizeitindustrie geworden, mit internationalen Stars, Weltranglisten und spektakulären Events wie den "Big Wave Awards", auf atemberaubenden Action-Shots millionenfach publiziert und ins Netz gestellt. Jim Heimanns Buch zeichnet diese Geschichte nach, mit mehr als 900 Bildern und Beiträgen renommierter Surfjournalisten.
Der Band folgt der Chronologie der Ereignisse vom Erstkontakt derEuropäer mit dem Surfen bis in unsere Tage der Eventkultur. Mehr als zwei Jahrhunderte Surf Culture, illustriert mit einer überwältigenden Fülle an Bildmaterial aus öffentlichen wie privaten Sammlungen und Archiven, kommentiert und erläutert von der ersten Liga des Surfschreibertums. Die Bibel für jeden Surffan, popkulturell Interessierten und Bilderhungrigen.
Was Anfang des letzten Jahrhunderts noch ein exotisches Vergnügen weniger Abenteurer war und später als Subkultur die Mythologie Kaliforniens prägte, ist im Mainstream angekommen und mit seinen rund 20 Millionen Aktiven weltweit und ungezählten Fans zur festen Größe der Freizeitindustrie geworden, mit internationalen Stars, Weltranglisten und spektakulären Events wie den "Big Wave Awards", auf atemberaubenden Action-Shots millionenfach publiziert und ins Netz gestellt. Jim Heimanns Buch zeichnet diese Geschichte nach, mit mehr als 900 Bildern und Beiträgen renommierter Surfjournalisten.
Der Band folgt der Chronologie der Ereignisse vom Erstkontakt derEuropäer mit dem Surfen bis in unsere Tage der Eventkultur. Mehr als zwei Jahrhunderte Surf Culture, illustriert mit einer überwältigenden Fülle an Bildmaterial aus öffentlichen wie privaten Sammlungen und Archiven, kommentiert und erläutert von der ersten Liga des Surfschreibertums. Die Bibel für jeden Surffan, popkulturell Interessierten und Bilderhungrigen.

Über das Wellenreiten wurden viele Bücher geschrieben, aber so eines noch nicht: Die Kulturgeschichte "Surfing 1778 - 2015" von Jim Heimann ist umwerfend und episch wie der Sport selbst.
Von Niklas Maak
Ich hatte mit den Surfern vorn am Strand geredet, als sie wieder aus den Wellen herauskamen. Auf dem Weg in die Wellen konnte man nicht mit ihnen reden, weil sie direkt von ihren alten Transportern, die sie oben auf der Düne parkten, im Laufschritt bis zum Ufer rannten, als würden sie von jemandem verfolgt: Sie warfen ihre Bretter ins hüfthohe Wasser und paddelten durch die flacheren Wellen hinaus, sie steuerten direkt auf die Wellen zu und drückten ihr Bord so nach unten, dass die Spitze in der Wasserwand verschwand und sie nicht umgeworfen wurden, und dann saßen sie im Line-up wie die Pelikane, die auch in der Dünung dümpeln und sich die Morgensonne auf den salzwasserfeuchten Schnabel brennen lassen.
Als sie wieder herauskamen, fragte ich sie, wie es dort draußen war, und sie sagten, es gäbe nichts Schöneres, als dort eine der ersten Wellen des Tages zu bekommen, und dann verschwanden sie mit ihren Brettern zu den rostigen Transportern und blinzelten ins Mittagslicht und aßen Sandwiches, auf die der Wind einen feinen Film aus Sand legte, und abends sah es aus, als hätten die Surfer eine Taschenlampe im Mund, so sehr blitzten ihre Zähne aus den verwitterten Sommergesichtern heraus.
Ich kaufte mir ein Longboard und probierte es. Was die Surfer nicht erzählt hatten, war, wie oft man vom Brett fliegt, bis man es kann. Dass man Salzwasser in sehr großen Mengen schluckt. Dass man vom Anpaddeln einen Muskelkater bekommt, der sich anfühlt, als habe einem ein böser Witzbold im Schlaf die Arme einbetoniert. Wie oft man, wenn man gerade glaubte, dass man es richtig gut kann, eine Welle erwischt, die einem zeigt, dass man es überhaupt nicht gut kann, jedenfalls nicht gut genug, wie man dann als letztes Signal aus der Welt des Sauerstoffs das wütende Geschrei der Locals hört, denen man die Welle versaut hat, und wie man dann die Luft anhält und versucht, herauszufinden, wo in dem Höllenstrudel aus weißem und dunklem Wasser und Sand oben und unten sein könnte und wie man das hektisch über einem durch die Luft rasende, mit einer Leash am Fuß befestigte Brett nicht gegen den Kopf bekommt: Wenn man sich vorstellt, man sei aus Versehen von einem schusseligen Riesen in seine Riesenwaschmaschine gesteckt und auf Schleudergang geschaltet worden, bekommt eine Ahnung davon, wie sich so ein Wipe Out anfühlt. Auch die Tatsache, dass Wasser so hart wie eine Teerstraße sein kann, ist eine der unangenehmen Erfahrungen, die man beim Wellenreiten macht.
Aber irgendwann trifft man morgens auf einem Parkplatz am Meer den Surfer Dylan Eckhardt, der einem auf surfertypische, also genial wortkarge, ins Gegenlicht hineinblinzelnde Art und Weise erklärt, was die Bewegung von beiden Händen auf eine und dann auf die andere Seite des Boards bewirkt, und dann fühlen sich die paar Tonnen Wasser unter einem plötzlich wie eine Erweiterung des eigenen Körpers an. Fortan ist es dieser magische Moment, der einen trotz Muskelkater, Wasserbauch und Beulen immer wieder Richtung Line-up treibt.
Es muss vor allem das Gefühl, Wasser vom Gewicht eines Elefanten so zu nehmen, dass es einen elegant an Land trägt, gewesen sein, dass die Könige Hawaiis schon vor vielen Jahrhunderten dazu verleitete, ihren Untertanen auf neunzig Kilo schweren Prunkbrettern vorzuführen, wie gut sie anarchische Riesenkräfte zu domestizieren wissen. Einige Surf-Historiker behaupten, das Wellenreiten sei entstanden, als ein paar Polynesier beim Fischfang mit ihren flachen Booten in die Brandungswellen gerieten - aber das ist natürlich Spekulation. Es waren am Ende weder Repräsentationslust noch die Nahrungssuche, was die Menschen schon vor Tausenden von Jahren in Polynesien, Tahiti und anderswo auf die Bretter und in die Wellen trieb, sondern der Spaß. Weshalb das Wellenreiten die europäischen Missionare vom ersten Moment an empörte. "Mit dem Fortschreiten der Zivilisierung lässt sich der Rückgang und die Einstellung der Benutzung des Surfbretts durch die Zunahme von Sittsamkeit, Fleiss und christlichem Glauben erklären", notierte 1847 der Prediger Hiram Bingham. Andere wollten die Teufelei des großen Rauschs selbst erleben: Für Jack London war der hawaiianische Surfer "ein brauner Merkur, er ist gelassen, bewegungslos". Er war fasziniert von "dieser gewaltigen Kraft, deren Ausdruck Wildheit, Gischt und Getöse sind", und dem "königlichen Sport für die natürlichen Könige der Erde", den er von übertriebenen Moralvorstellungen bedroht sah. Seine Freunde gründeten daraufhin 1908 gewissermaßen als Schutzprogramm für bedrohte Sportarten den ersten Surfclub der Welt, den "Outrigger Canoe and Surfboard Club". Was dann passierte, erzählt der Surfer Jim Heimann in seiner sechshundert Seiten umfassenden Kulturgeschichte des Surfens, die mehrere Kilo schwer und so großformatig ist, dass einem die Bilder selbst wie große Brecher entgegenkommen: Wenn die Floskel, man tauche in die Bilder ein, je angebracht war, dann hier.
Von den in Stein eingeritzten ersten Darstellungen von Wellenreitern, die auf Hawaii im sechzehnten Jahrhundert entstanden, über die Radierungen erstaunter Missionare aus dem achtzehnten und neunzehnten Jahrhundert, von den ersten Fotografien hawaiianischer Surfer über die psychedelisch bunten Werbeplakate bis zu neueren Filmstills und zahllosen Privataufnahmen wird hier die umfassendste und schönste Bild- und Kulturgeschichte des Wellenreitens ausgebreitet wie ein gigantisches Frotteehandtuch im Sand: Man sieht die Kahanamoku-Brüder 1924 an Waikiki-Beach trainieren, und wenn man den Biographen glauben darf, war dies der Moment, von dem an Surfer auch in der westlichen Welt wie Halbgötter gefeiert wurden, die die abenteuerliche Aura von Cowboys mit dem Rebellentum von Indianern verbinden - mit der Folge, dass jeder einer werden wollte. Heimanns Buch ist nicht nur eine Kultur-, sondern auch eine Technikgeschichte des Surfens, man erfährt alles über die Entwicklung des Bretts vom hölzernen Malibu zum High-tech-Fiberglass-Shortboard. Vor allem aber überträgt dieses Buch auf eine geradezu alchemistische Weise die versandete, gischtige, gegenlichtig goldene Atmosphäre langer Surfsommer: verstaubte Autos auf Schotterpisten zum Meer, Strandbuden, Sonnenbrände, Bretter im Sand neben einem Lagerfeuer. Niemand hat diese Stimmung besser in Bilder gefasst als Don James, der eigentlich Zahnarzt war und sich unter anderem um das Gebiss von Clark Gable kümmerte. Aber in den Jahren von 1936 bis 1942 hatte er, als Fünfzehn- bis Einundzwanzigjähriger, seine Zeit an den Stränden zwischen San Onofre und Point Dume verbracht, er hatte die Jugendlichen fotografiert, die in den Zeiten der Weltwirtschaftskrise auf Arbeit warteten - was sie, weil sie in Los Angeles lebten, am Strand taten, wo sie ihr Mittagessen am Pier fischten, in alten T-Modellen schliefen und sich tagsüber die Zeit mit Wellenreiten vertrieben.
Man sieht auf diesen Bildern, wie sich die dunkle, glatte Fläche des scheinbar reglosen Pazifiks plötzlich wellt, wie die Wellen hereinkommen in die Bucht und wie die Surfer auf diesen kleinen, aber kräftigen Wellen wie Statuen aus einem Gemälde von de Chirico an Land gleiten. Man erkennt auch die ungeheure Eleganz der Sache, die Spannung und den perfekten Punkt, den jemand erwischt hat und wie er jetzt von der gebündelten Kraft eines ganzen Ozeans nach vorn getrieben wird; man sieht verbrannte Haut und weiße Zähne und lange Wimpern unter salzig verzotteltem Haar und Muskeln unter brauner Haut und leere Bierflaschen und eine insgesamt überhitzte, salzige und angetrunkene Welt, die von Gischt und kaltem Pazifikwasser wieder reingewaschen wird. Man sieht Surferinnen, die in übergroßen T-Shirts tanzen. Am Strand von Malibu wurde die amerikanische Geschichte im Miniaturformat nachgespielt: Junge Leute verließen die Zivilisation und suchten ihr Glück weiter draußen, sie lebten wie die Trapper auf dem Zug nach Westen, in Zelten, in ihren Wagen am Strand oder am Lagerfeuer; nur dass die Berge, die es zu bezwingen galt, jetzt aus Wasser waren, und es ist kein Zufall, wenn Stacy Peralta, der Regisseur des Surffilms "Riding Giants", den legendären Longboard-Surfer Greg Noll einen Cowboy des Pazifiks nennt.
Nach 1945 trugen Filme wie "Gidget", die Geschichte eines wellenbegeisterten Mädchens, aber auch so abstruse Taschenbücher wie George Snyders "Surfside Sex - Living with Savage Passions and Raw Desire" zur Verbreitung des Surfens bei. Vor "Gidget" gab es weltweit etwa fünftausend Surfer, 1964 waren es zwei Millionen. Vielleicht war es auch diese Verwandlung in einen Massensport, die die echten Surfer in immer extremere Wellen trieb. Surfer wie Darrick Doerner, Laird Hamilton und der Windsurfer Peter Cabrinha zettelten in den vergangenen Jahren einen lebensgefährlichen Wettbewerb an. Der junge Surfer Mark Foo verschwand an einem stürmischen Tag bei Mavericks in einer Welle und tauchte nie wieder auf. Mike Parsons fuhr eine Sechzig-Fuß-Welle an der Cortes Bank; wenig später schaffte der Brasilianer Carlos Burle achtundsechzig Fuß, dann kam Cabrinha und fuhr eine Siebzig-Fuß-Welle - das ist höher, als in Berlins Innenstadt die Häuser sein dürfen.
Die meisten Menschen, die man in diesem Buch sieht, verkörpern das Gegenteil dieser tragischen Extremsportler: totale Entspannung. Für sie ist das Wellenreiten ein Lebensentwurf, ein Grund, das Leben insgesamt so weit wie möglich in einen endlosen Strand zu verwandeln. Was eine gute Idee auch für die ist, die nie surfen waren oder es wollen. Auch deswegen ist dieses Buch eine perfekte Anleitung, der ideale Start in den Sommer.
"Surfing 1778-2015" von Jim Heimann. Taschen Verlag, Köln 2016. 592 Seiten, zahlreiche Abbildungen. Gebunden, 150 Euro.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
"Wow! Das spektakulärste Coffeetable-Book, das wir je in den Händen hielten... Dieses Teil ist ein wahres haptisches wie visuelles Feuerwerk... Dieses Buch ist ein absolutes Must-have für alle Fans des Surfens!" Prime Surfing, Berlin