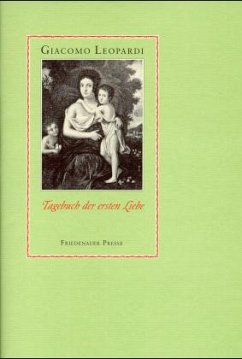Vom 11. bis 14. Dezember 1817 ist eine junge Verwandte, Gertrude Cassi-Lazzari, zu Gast im Haus der Familie Leopardi. Giacomo Leopardi verliebt sich in seine schöne, um sieben Jahre ältere Cousine. Die Erfahrung dieser Liebe schlug sich in dem Gedicht "Die erste Liebe" und in einem wohl nicht zur Veröffentlichung bestimmten Prosatext, dem "Tagebuch der ersten Liebe" nieder. Während in den Terzinen des Gedichts der Einfluß Petrarcas durchscheint, enthält die Prosa des Tagebuchs eine höchst eigenwillige Mischung aus Spontaneität und Bewußtsein; es ist, als ließe sich die stilistische Gewandtheit des jungen Schreibers durch das Staunen da und dort gern aus dem Gleichgewicht bringen. Dabei verwendet er nicht die Bilder der Welt, um zu beschreiben, wie elend ihm zumute ist, sondern er geht seinen eigenen Erfahrungen und Empfindungen nach, um sich und uns zu zeigen, wie es "in den Eingeweiden der Liebe" aussieht.
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Rezensent Thomas Steinfeld liest Giacomo Leopardis dichterische Verarbeitung der ersten Liebe zusammen mit den Tagebucheinträgen des Dichters von 1817 mit Gewinn. Die Übersetzung von Marianne Schneider und das Nachwort von Frank Witzel bieten ihm eine gelungene Hilfestellung für das Verständnis der Texte. Wie Leopardi Ereignis und Gefühl in Worte fasst, ist Steinfeld aber durchaus auch ganz unmittelbar zugänglich. Staunenswert scheint Steinfeld die Modernität des Autors, der sich so kunstvoll von herkömmlichen Formen für die Darstellung von Empfindungen verabschiedet.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH