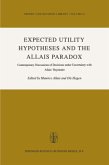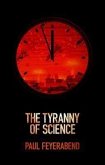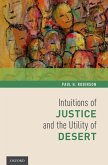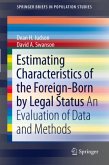Produktdetails
- Verlag: Princeton University Press
- Seitenzahl: 176
- Erscheinungstermin: 2. August 2011
- Englisch
- Abmessung: 252mm x 157mm x 20mm
- Gewicht: 426g
- ISBN-13: 9780691128177
- ISBN-10: 0691128170
- Artikelnr.: 32724029
- Herstellerkennzeichnung Die Herstellerinformationen sind derzeit nicht verfügbar.

Eine notwendige Kritik der Verhaltensökonomik
Seit einiger Zeit demontieren Verhaltensökonomen das Modell des "Homo oeconomicus". Sie zeigen experimentell, dass Menschen in vielen Situationen systematisch von den Verhaltensvorhersagen abweichen, die aus dem Modell des strikt rationalen Nutzenmaximierers folgen. Menschen machen Fehler, sind unsicher bei Entscheidungen, sie brechen Vorsätze und bereuen Handlungen.
Die Verhaltensökonomik hat also empirische Mosaiksteinchen zusammengetragen, die das alte Paradigma in Frage stellen, die jedoch noch kein kohärentes neues Paradigma bilden. Die Tendenz ihrer Politikempfehlungen ist aber klar: Der Staat solle eingreifen und die Menschen auf den "richtigen Weg" lenken, da sie selbst unfähig sind, das für sie Beste zu erkennen und zu verwirklichen.
Der französische Wirtschaftsprofessor Gilles Saint-Paul (Universität Toulouse I) hat nun eine brillante Schrift vorgelegt, die sich dem paternalistischen Trend entgegenstemmt. Saint-Paul gehört zu der leider seltener werdenden Spezies Ökonomen, die philosophisch gebildet sind und die dogmengeschichtlichen Grundlagen ihres Faches noch kennen und ernst nehmen.
Sein Buch spannt den Bogen von der aufklärerisch-liberalen Philosophie über den Utilitarismus bis zur modernen Verhaltensökonomik und Glücksforschung. Die Hauptaussage lautet: Sollte sich das paternalistische Denken durchsetzen, dann droht Gefahr für die freiheitliche Gesellschaft. Ins Extrem getrieben, kann der Paternalismus in die totalitäre Vision einer Wohlfahrtsdiktatur münden.
Davon sind wir weit entfernt, doch weist Saint-Paul zu Recht auf entsprechende Tendenzen hin. Zunehmend mischen sich Staaten in das tägliche Leben der Bürger ein, die sie vorgeblich vor sich selbst schützen wollen. Die Rechtfertigung für viele Eingriffe liefert die Verhaltensökonomik: Statt der klassischen Position des "Homo oeconomicus", der durch seine Handlungen seine Präferenzen offenbart, entsteht das Bild eines unmündigen Kind- oder Triebmenschen, der von Vater Staat erzogen und durch Schubser ("Nudges") zu besserem Verhalten geleitet wird.
Die Regierung sorgt dafür, dass sich die Bürger besser ernähren, dass sie genügend Sport treiben, für ihr Alter sparen oder dass sie ihre Organe der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Beim "sanften Paternalismus" bleiben zwar durchaus Wahlmöglichkeiten bestehen, doch werden die "Standardeinstellungen" ("default options") so verändert, dass die Menschen "das Richtige" tun.
Wie Saint-Paul ausführt, verschiebt sich auch der Ansatz der erzieherischen Maßnahmen. Da der Wohlfahrtsstaat, der Risiken sozialisiert, durch unverantwortliches Verhalten der Teilnehmer hohe Kosten hat, dieses Verhalten aber nicht sanktionieren will, geht er zunehmend zu präventiven Maßnahmen über. Ein Beispiel: Der Fettleibigkeitsepidemie durch Fast-Food-Ernährung wird nicht so begegnet, dass verfressene Menschen mehr Eigenverantwortung übernehmen, indem sie privat einen Teil der Behandlungskosten zahlen müssen, sondern es werden - jüngst sogar von den Vereinten Nationen (UNO) - Zucker- und Fettsteuern gefordert.
Solche "Sündensteuern" wirken präventiv und können externe Effekte (die Kosten für das Gesundheitswesen) internalisieren. Sie treffen aber alle, auch die vernünftigen Konsumenten. Äußerst fragwürdig findet Saint-Paul auch den Ansatz des Glücksforschers Richard Layard, der die Menschen vor zu viel Arbeit und Konsumstreben, die nicht glücklich machten, durch höhere Grenzsteuern bewahren will.
Der kühle "Homo oeconomicus" war tatsächlich nur eine Fiktion. Was aber folgt daraus, wenn man die Annahme des von einem einheitlichen, klaren Verstand geleiteten Menschen wegfällt und man ihn stattdessen als widersprüchliche, gespaltene Persönlichkeit begreift? Saint-Paul verweist auf Sigmund Freuds Theorie vom zwischen Über-Ich, Ich und Es hin- und hergerissenen Menschen. Oder Stevensons Schauergeschichte "Dr. Jekyll und Mr. Hyde": Der ehrbare Bürger hat eine dunkle Seite als triebgesteuerter Verbrecher, die er nicht unter Kontrolle kriegt. In feministischen Kreisen war es nicht unüblich, in jedem Mann den potentiellen Vergewaltiger zu sehen.
Saint-Paul erinnert daran, dass an amerikanischen Universitäten männliche Professoren Gespräche mit Studentinnen nur noch bei offener Türe führen dürfen; in vielen Unternehmen und Behörden ist es Männern inzwischen verboten, alleine mit einer Frau einen Fahrstuhl zu besteigen. Ein generelles Klima des Verdachts verdrängt die freiheitliche Atmosphäre.
Nach Ansicht des französischen Ökonomen setzte das Elend der paternalistischen Ökonomik nicht erst mit der "behaviouristischen" Wende ein, sondern schon im Utilitarismus, der ein geeignetes soziales Design zur Maximierung der Gesamtwohlfahrt anstrebte. Schon darin lag der Keim für Zwangsbeglückung durch wissenschaftliche Experten. Das einzige Gegenmittel - und dafür plädiert Saint-Paul - wäre die Rückkehr zu einer Ökonomik, die Freiheit wieder als eigenständigen Wert anerkennt, auch wenn Menschen dann die Freiheit haben, Fehler zu machen.
PHILIP PLICKERT.
Gilles Saint-Paul: The Tyranny of Utility.
Princeton University Press, Princeton und Oxford 2011, 163 Seiten, 31,99 Euro
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main