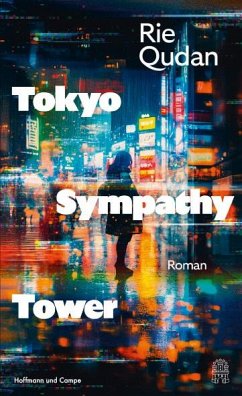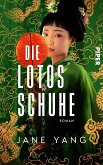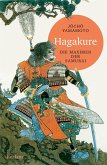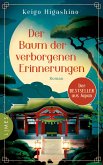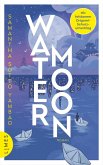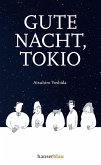Tokyo in naher Zukunft. Die gefeierte Stararchitektin Sara Makina darf sich an dem Wettbewerb zum Bau des „Tokyo Sympathy Tower“ beteiligen, aber was ihr fehlt, ist Inspiration. Der Turm wird in Nachbarschaft zum umstrittenen Nationalstadion von Zaha Hadid und Tokyos größtem Park entstehen und die
Stadt überragen. Aber Sara Makina findet keinen mentalen Zugang zu dem Projekt, denn die Bezeichnung…mehrTokyo in naher Zukunft. Die gefeierte Stararchitektin Sara Makina darf sich an dem Wettbewerb zum Bau des „Tokyo Sympathy Tower“ beteiligen, aber was ihr fehlt, ist Inspiration. Der Turm wird in Nachbarschaft zum umstrittenen Nationalstadion von Zaha Hadid und Tokyos größtem Park entstehen und die Stadt überragen. Aber Sara Makina findet keinen mentalen Zugang zu dem Projekt, denn die Bezeichnung „Sympathy Tower“ verleugnet den wahren Zweck des Gebäudes: Es wird ein luxuriöses Gefängnis werden, aber nicht nur der unbeholfen englische Name des Turms, sondern auch die politischen Vorgaben und Ideologien machen es der Architektin schwer. Obwohl ihr Arbeitsmittel der Zeichenstift ist, sind es letztlich die fehlenden Worte, die sie blockieren, bis ihr jugendlicher Liebhaber den Schlüssel findet. Aber eine Erlösung wird es nicht.
Mir war bisher nicht bewusst, dass auch in Japan ein existenzieller Kampf der Ideologien ausgetragen wird, ähnlich wie bei uns, aber bei näherer Betrachtung erscheint das egalitäre Gesellschaftssystem Japans dafür wie gemacht. Auch in Japan wird auf Sprache und Sprachgebrauch massiv Einfluss genommen. Bei Sara Makina führt der Verlust der Worte zum Verlust ihrer Kreativität. Was man nicht sagen kann, kann man auch nicht denken, so wie George Orwell in „1984“ mit „Neusprech“ die Hirne der Bevölkerung programmierte.
Heute definiert die woke Ideologie die Bedeutung der Worte um, verbietet sie oder schreibt sie vor, und übt als dogmatische Wächterin über das „Gute“ letztlich eine Gewaltherrschaft über die Sprache aus. So verkehrt sich in der Architektur des Tokyo Sympathy Towers der Sinn eines Gefängnisses in sein Gegenteil: Dem Verbrecher gilt unser Mitleid, nicht dem Opfer. Das ist nicht weniger wirr als die woke Wortschöpfung der „propalästinensischen Demonstrationen“. Das Opfer wird zum Täter und umgekehrt; wer anderes behauptet, wird isoliert und geächtet.
Rie Qudan nimmt in ihrem Buch mehrere Erzählperspektiven ein, jeweils aus der Ich-Sicht Sara Makinas und ihres Liebhabers Takuto. Sara steht für die Vergangenheit und Vergänglichkeit, Takuto für die Schönheit, Jugend und Zukunft. Saras Reichtum ermöglicht es ihr, sich vielen japanischen Regeln zu widersetzen: Sie hält sich einen deutlich jüngeren Liebhaber, sie ist laut und rücksichtslos und doch ist ihr Leben in gewisser Weise leer. Ihr elitärer Turm ist Vermächtnis und Schicksal zugleich.
Ich habe bis zum Schluss nicht herausgefunden, ob der Roman nun eine Kritik an der erzwungenen Egalisierung oder deren Lob ist. Einerseits bedient Rie Qudan in Japan weit verbreitete rassistische Vorurteile, indem sie den einzigen in der Geschichte vorkommenden Ausländer als übergewichtig, stinkend, haarig, laut, ordinär und rücksichtslos beschreibt, ohne jedes Verständnis für die japanische Kultur („das versteht man eben nur, wenn man Japaner ist“). Dabei ist sie selber, wie ihr Name verrät, ebenfalls nicht-japanischer Herkunft und musste ganz sicher unter Vorurteilen leiden. Andererseits durchzieht den Text aber der Wunsch nach Gleichheit, Toleranz und Glück für alle, ganz besonders für die von der Gesellschaft Ausgestoßenen. Aber vielleicht ist dieses Sowohl-als-auch in keinem Land so sehr Realität wie in Japan. Nur aus dem Gefängnis der Worte kann niemand entfliehen.