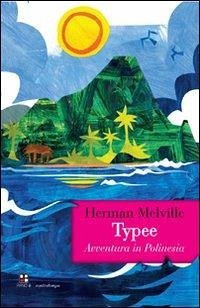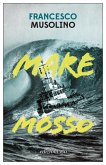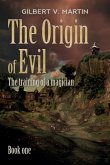"Typee. A peep at Polynesian life" è il romanzo d'esordio di Herman Melville, il quale si impose all'attenzione del pubblico e della critica. Fu da subito un caso letterario, e fino alla seconda metà del Novecento era considerato il suo capolavoro. Molto più di un affresco esotico e picaresco, "Typee" è un romanzo "vero" fino quasi a confondersi con la cronaca, è insieme opera biografica, inno alla natura, diario avventuroso e trattato antropologico. Si narrano le gesta realmente accadute al mozzo ventitreenne Herman Melville e al suo fedele amico Toby, che dopo oltre un anno e mezzo di navigazione sulla baleniera Acushnet decidono di disertare nel mezzo del Pacifico, sulle isole Marchesi, un paradiso terrestre di cui però conoscono pericoli e avversità: è un eden abitato da terribili tribù cannibali. In "Typee", l'avventura e il reportage, le sofferenze fisiche e il terrore dell'ignoto si svolgono sempre sullo sfondo dell'incontaminata società polinesiana, incorrotta, libera e felice, che Melville coglie durante il suo lento annientamento per mano della feroce e ipocrita colonizzazione occidentale. Das Urheberrecht an bibliographischen und produktbeschreibenden Daten und an den bereitgestellten Bildern liegt bei Informazioni Editoriali, I.E. S.r.l., oder beim Herausgeber oder demjenigen, der die Genehmigung erteilt hat. Alle Rechte vorbehalten.

Herman Melvilles "Typee"
Das Buch trug keine gängige Gattungsbezeichnung, und genau diese Uneindeutigkeit machte 1846 seinen Erfolg aus: In "Typee" erzählte der junge Debütant Herman Melville von seinen Reisen als Seemann und vor allem von einigen Monaten in einem abgeschiedenen Inseltal als entlaufener Matrose, der Unterschlupf bei einem gastfreundlichen Südsee-Stamm fand, der noch nicht intensiv mit Fremden in Kontakt gekommen war. So weit, so nahe an Melvilles eigenen Erlebnissen. Ob es aber sexuell tatsächlich so freizügig bei den Typee (der Name des Stammes) zugegangen ist, wie im Buch vom Ich-Erzähler Tom berichtet, kann mangels anderer Berichte Melvilles nicht mehr rekonstruiert werden. Seine Erzählung traf jedenfalls genau den Nerv im prüden England des frühen Viktorianischen Zeitalters und dem noch prüderen Amerika. Und der Untertitel tat das Seine dazu: "A Peep at Polynesian Life".
Warum Alexander Pechmann in seiner Neuübersetzung darauf verzichtet hat, den "Schlüssellochblick", was wohl die gängige deutsche Entsprechung für peep gewesen wäre, entfallen zu lassen und das Buch nun ganz ohne Gattung auf die Leser loszulassen, erläutert er leider nicht in seinem umfangreichen Nachwort. Dafür liest sich diese insgesamt vierte deutsche Übertragung von Melvilles zu Lebzeiten mit Abstand erfolgreichstem Buch sehr gut, weil Pechmann den Erzählton des neunzehnten Jahrhunderts auch ohne Archaismen trifft - wer "Vorkehrungen" statt "Vorbereitungen" sagt, ist diesbezüglich auf dem richtigen Weg. Hoffentlich wird er auch noch "Omoo" übertragen, die Fortsetzung zu "Typee" mit weiteren Abenteuern von Peeping Tom.
apl.
Herman Melville: "Typee".
Hrsg. und aus dem Amerikanischen von Alexander Pechmann. Mare Verlag, Hamburg 2019. 447 S., geb. im Schuber, 38,- [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main