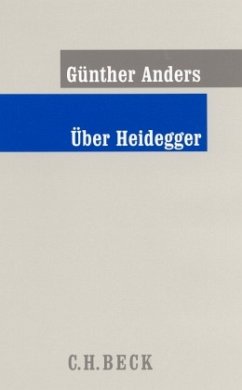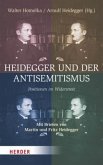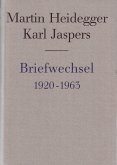1881 verbringt Friedrich Nietzsche seinen ersten Sommer in Sils-Maria im Oberengadin. Hier im Hochgebirge, 6000 Fuß jenseits von Mensch und Zeit , hat er an einem hellen Augustvormittag 1881 ein Offenbarungserlebnis, das er im Rückblick immer stärker mystifizieren wird: die Erkenntnis von der ewigen Wiederkehr. Ausgehend von diesem Erlebnis und dem Gedanken, der ein Angelpunkt seines Werks werden soll, schildert Sabine Appel Nietzsches persönlichen und werk-geschichtlichen Werdegang auf seinen diversen Stationen: Röcken, Naumburg und Schulpforta, Bonn, Leipzig, Basel und Tribschen, Bayreuth, Basel, Sorrent, St. Moritz, Venedig, Genua, Sils-Maria, Rapallo, Nizza, Turin, Basel, Jena und schließlich Weimar, umnachtet seit Jahren und so auch auf seiner letzten Station. Mit Sensibilität und kritischer Reflexion zeichnet Sabine Appel den Weg eines Denkers nach, der wie niemand sonst das Selbstverständnis des 20. Jahrhunderts geprägt hat, dem aber in seine letzte Nacht niemand mehrfolgen konnte.
Perlentaucher-Notiz zur NZZ-Rezension
Ludger Heidbrink bespricht zwei Bücher über Heidegger, die sich zumindest in zweierlei Hinsicht ähnlich seien: Beide kritisieren laut Heidbrink Heideggers antivitalistischen Standpunkt und beide heben die Bedeutung der Bedürfnisnatur hervor.
1) Günther Anders: "Über Heidegger"
Günther Anders kritisiert allerdings, wie Ludker Heidbrink darstellt, die Haltung Heideggers, der sich einer Stellungnahme zu den Problemen der Moderne verweigere. Heideggers Existenzialphilosophie spiegele die "radikale Vereinzelung des kleinbürgerlichen Individuums wider" und entziehe sich einer anthropologischen Fundierung des Individuums, fasst Heidbrink Anders Kritik Anders zusammen. So seien Anders gesammelte Aufsätze Ausdruck einer "tiefen Unzufriedenheit über die Tatenlosigkeit der Philosophie".
2) Peter Solterdijk: "Nicht gerettet. Versuche über Heidegger"
Dagegen übernehme Sloterdijk in gewisser Hinsicht den Ansatz Heideggers, meint Heidbrink, und führe diesen weiter, in dem er dessen Dekonstruktion des Menschen mit der Frage nach den Möglichkeiten der "Anthropotechniken" verbinde. So stelle Sloterdijk fest, dass der Mensch immer bereits "hybrid" gewesen sei, insofern er seine biologische Mangelhaftigkeit durch technologische Konstruktionen auszugleichen versuche. Ein Versuch demnach, sich dem Unausweichlichen zu überlassen, ohne die Kontrolle über die Entwicklungen zu verlieren, wie Heidbrink zusammenfasst.
© Perlentaucher Medien GmbH
1) Günther Anders: "Über Heidegger"
Günther Anders kritisiert allerdings, wie Ludker Heidbrink darstellt, die Haltung Heideggers, der sich einer Stellungnahme zu den Problemen der Moderne verweigere. Heideggers Existenzialphilosophie spiegele die "radikale Vereinzelung des kleinbürgerlichen Individuums wider" und entziehe sich einer anthropologischen Fundierung des Individuums, fasst Heidbrink Anders Kritik Anders zusammen. So seien Anders gesammelte Aufsätze Ausdruck einer "tiefen Unzufriedenheit über die Tatenlosigkeit der Philosophie".
2) Peter Solterdijk: "Nicht gerettet. Versuche über Heidegger"
Dagegen übernehme Sloterdijk in gewisser Hinsicht den Ansatz Heideggers, meint Heidbrink, und führe diesen weiter, in dem er dessen Dekonstruktion des Menschen mit der Frage nach den Möglichkeiten der "Anthropotechniken" verbinde. So stelle Sloterdijk fest, dass der Mensch immer bereits "hybrid" gewesen sei, insofern er seine biologische Mangelhaftigkeit durch technologische Konstruktionen auszugleichen versuche. Ein Versuch demnach, sich dem Unausweichlichen zu überlassen, ohne die Kontrolle über die Entwicklungen zu verlieren, wie Heidbrink zusammenfasst.
© Perlentaucher Medien GmbH