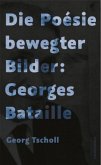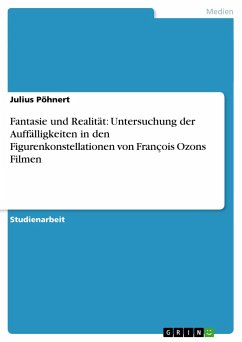Der Band versammelt Aufsätze, die Jacques Rancière seit Mitte der 90er Jahre für die französischen Filmzeitschriften Cahiers du Cinéma und Trafic geschrieben hat. In Auseinandersetzung mit zeitgenössischen Regisseuren wie Abbas Kiarostami, Takeshi Kitano oder Pedro Costa, aber auch mit Klassikern wie Robert Bresson, John Ford und Charlie Chaplin erweitert Rancière das Spektrum seiner politischen Filmästhetik, die sich zentral am Begriff der Fiktion entfaltet. Im Namen der politischen Fiktion polemisiert Rancière dabei gegen jene "Infra"- und "Ultra"-Fiktionen, die das Kino im Regime des Konsens einsperren.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Als eines der wichtigsten neuen Bücher zum Film bezeichnet Bert Rebhandl diesen schmalen Band mit Texten, die Jacques Rancière zwischen 1998 und 2001 für die "Cahiers du Cinema" verfasst hat. Über eine bloße Vertröstung bis zur angekündigten Übersetzung von Rancières "Filmfabeln" geht der Band laut Rebhandl hinaus, der den Autor jeweils auf ein paar Seiten nur, doch, wie Rebhandl findet, unnachahmlich über Arbeiten von John Ford oder Takeshi Kitano philosophieren lässt. Zweierlei ist für den Rezensenten bemerkenswert: Rancières besonderes Verständnis des Kinos als zwischen Repräsentation und Autonomie changierendes Gesamtkunstwerk. Und die Darbietung eines eigenen Modells, das immer wieder die bekannten ästhetischen Dichotomien durchkreuzt, indem es den Leser auf die kleinen Exaltationen im filmischen Realismus hinstößt. Dafür ist Rebhandl dankbar.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH