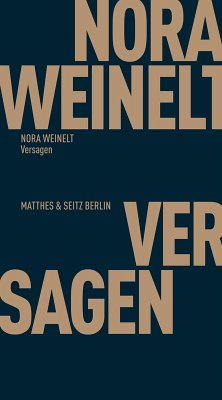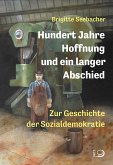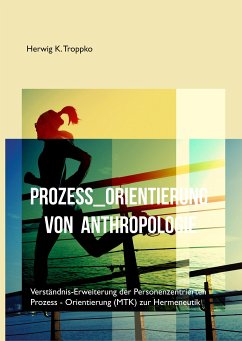Jemanden einen Versager zu nennen, ist die größtmögliche Beleidigung, wurzelt darin doch das Urteil, dass sich im Versagen der angesprochenen Person etwas Bahn gebrochen hat, das ohnehin nicht zu vermeiden war: Wer versagt hat, hat das eigene Leben verfehlt, wer versagt hat, ist unfähig, das zu leisten, was allen anderen Menschen scheinbar mühelos gelingt. Neben dem sozialen Urteil, das andere über einen fällen, existiert jedoch auch die Selbstbezichtigung: Ich habe versagt. Doch ab wann man von Versagen spricht, dafür gibt es keine genauen Kriterien.
Nora Weinelt zeichnet die Wege nach, über die der aus der Mechanik stammende Begriff des Versagens Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch findet, und zeigt, dass er erst in unserer postmodernen Gesellschaft, in der noch jedes Scheitern nachträglich als Etappe zum Erfolg beschrieben werden muss, seine ganz und gar vernichtende Schlagkraft voll entfaltet.
Nora Weinelt zeichnet die Wege nach, über die der aus der Mechanik stammende Begriff des Versagens Eingang in den allgemeinen Sprachgebrauch findet, und zeigt, dass er erst in unserer postmodernen Gesellschaft, in der noch jedes Scheitern nachträglich als Etappe zum Erfolg beschrieben werden muss, seine ganz und gar vernichtende Schlagkraft voll entfaltet.
Perlentaucher-Notiz zur FR-Rezension
Kluge, teils auch beängstigende Gedanken zum Thema Versagen bringt Nora Weinelt hier laut Rezensent Harry Nutt zu Papier. Versagensvorwürfe, so eine These des Buches, haben mehr mit Selbstzweifeln als mit Fremdzuschreibungen zu tun. Die kulturhistorische Darstellung des Themas läuft Nutt zufolge darauf hinaus, dass Versagen zunächst vor allem eine technische Kategorie war, ab dem 19. Jahrhundert jedoch ins Soziale übertragen wird, im Zuge der Durchsetzung einer kapitalistischen Leistungsgesellschaft, die eine Kaste der Versager hervorbringt. Weinelt kann ihre Gedanken anhand verschiedener Beispiele gut darstellen, so der Rezensent, unter anderem an der gebräuchlichen Rhetorik von Managementschulen oder auch an den Romanen Michel Houellebecqs, die prototypische Versager ins Zentrum stellen. Besonders problematisch, lernt Nutt, wird es freilich dann, wenn Versagensvorwürfe auf das gesellschaftliche Ganze projiziert werden, wie etwa in der Rede vom Staatsversagen. Es handelt sich also, so das Fazit, nicht nur um ein starkes, sondern auch um ein hochaktuelles Buch.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH