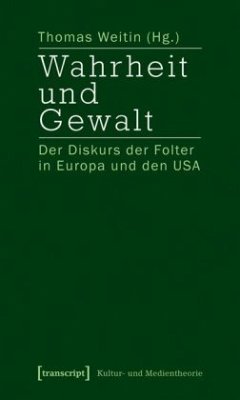Die Diskussion um die Folter enthüllt eine tiefe Krise im Verhältnis des Menschen zur Gewalt. Sie erschüttert die Vorstellungen vom fortschreitenden Zivilisationsprozess.
Die weltweite Rückkehr der Folter steht für reale Gewalt, die keineswegs in formell undramatischer, struktureller Gewalt aufgeht. Gleichwohl tritt uns die physische Gewalt in medialen Erscheinungsbildern entgegen, die in Europa und den USA unterschiedlich bestimmt sind. Die Beiträge des Bandes untersuchen diese Zusammenhänge aus historischer, literatur- und medienwissenschaftlicher sowie juristischer Perspektive - und zeigen: Die globale Gewalt hat viele Gesichter. Ihre verheerenden Auswirkungen zeichnen sich gerade erst ab.
Die weltweite Rückkehr der Folter steht für reale Gewalt, die keineswegs in formell undramatischer, struktureller Gewalt aufgeht. Gleichwohl tritt uns die physische Gewalt in medialen Erscheinungsbildern entgegen, die in Europa und den USA unterschiedlich bestimmt sind. Die Beiträge des Bandes untersuchen diese Zusammenhänge aus historischer, literatur- und medienwissenschaftlicher sowie juristischer Perspektive - und zeigen: Die globale Gewalt hat viele Gesichter. Ihre verheerenden Auswirkungen zeichnen sich gerade erst ab.

Worüber redet, wer von Folter spricht? Von großen körperlichen oder seelischen Schmerzen, von Leiden und Lust, Zwang und Zeugnis, Voyeurismus und Verbrechen, von Menschenwürde und Martyrium. Die Beiträge dieses Bandes untersuchen Form und Inhalte des Folterdiskurses aus historischen, juristischen sowie literatur- und medienwissenschaftlichen Perspektiven. Art und Weise der Darstellung von Folter sind eng mit normativen und politischen Fragen verbunden. Es lassen sich dabei deutliche transatlantische Differenzen ausmachen. Wobei die Bilder aus Abu Ghraib, wie der Literaturwissenschaftler Klaus Mladek zeigt, nicht nur Zeugnisse der Schamlosigkeit, einer schamlosen Sexualisierung von Krieg, Geheimdienstarbeit und scharfem Verhör sind. Sie rufen Erinnerungen aus dem Bildgedächtnis der abendländischen Foltertradition wach. Die Gewalt der Folter wurde durch die Aufklärung nicht abgeschafft, sondern transformiert. Die "peinliche Befragung" fand, so die These des Herausgebers Thomas Weitin, ihre Fortsetzung mit anderen Mitteln, die doch vertraute waren: "Es lässt sich zeigen, dass bei der Folter zur Beweiserzwingung seit jeher der psychische und verbale Druck die entscheidende Rolle spielte und dass diese Gewalt von der Abschaffung nicht nur nicht betroffen war, sondern nach dem Verbot verstärkt in den Vordergrund trat." Dem Subjekt sollte überlegenes Wissen abgenötigt werden. Dies aber belegen die Fotos der Folterknechte: In Abu Ghraib und Guantánamo ging es nicht mehr um Wahrheit, sondern nur noch um nackte Gewalt. ("Wahrheit und Gewalt". Der Diskurs der Folter in Europa und den USA. Hrsg. v. Thomas Weitin. transcript Verlag, Bielefeld 2010. 293 S., br., 29, 80 [Euro].)
ake
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
»Der Band bietet einige lesenswerte Zugänge zum Phänomen.«
Joachim Comes, Ethica, 19/3 (2011) 20110930
Joachim Comes, Ethica, 19/3 (2011) 20110930