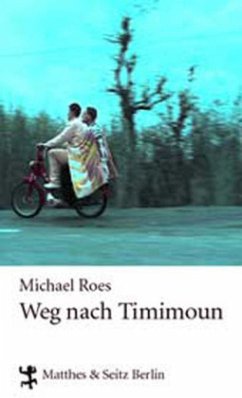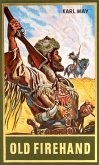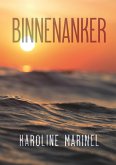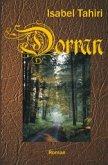WEG NACH TIMIMOUN ist die abenteuerliche Reise zweier Jugendlicher durch das von politischen und religiösen Spannungen geprägte Algerien. Im Mittelpunkt steht Laid, der zwischen seinem modernen, europäisch geprägten Leben in der Großstadt am Meer und den Erinnerungen an seine Kindheit in einem traditionellen Oasendorf in der Sahara zerrissen zu werden droht. Mit seinem Freund Nadir macht er sich auf die spannungsvolle Fahrt in die Vergangenheit.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.