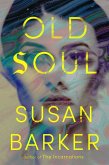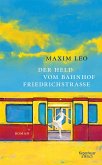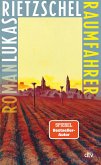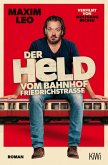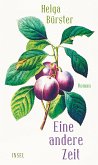Mit Wärme, Wucht und Witz erzählt Paula Fürstenberg in »Weltalltage« von einer besonderen Freundschaft und deren Zerreißprobe. Davon, was es heißt, nicht zu funktionieren in einer Welt, in der alles funktionieren muss; vom Körper und wie wir mit ihm umgehen; von der Kraft der Worte und davon, wo Empathie beginnt - und wo sie enden muss.
Sie sind beste Freunde seit der Schulzeit. Jetzt, mit Anfang dreißig, teilen sie sich eine Wohnung. Max ist Architekt, sie ist Schriftstellerin und seit ihrer Kindheit chronisch krank. Immer wieder wird sie von heftigen Schwindelanfällen heimgesucht und ist auf Max angewiesen. Er ist der Gesunde, sie die Kranke. So war es schon immer. Doch dann erfährt Max vom Tod seines Onkels, und in ihm wächst eine Finsternis. Er muss ins Krankenhaus. Mit einem Mal gerät alles ins Wanken.
Was der Schriftstellerin im aufkommenden Freundschaftskummer hilft, ist das Schreiben, das versuchsweise Ordnen der Vergangenheit in Listenform. Also erzähltsie ihre Geschichte, und damit auch die von Max, von der Nachwendekindheit im Osten bis in die schwankende Gegenwart. Sie denkt über die gesellschaftlichen Verhältnisse nach, die sie zu denen haben werden lassen, die sie sind, über das Kranksein - und die Sprache der Körper.
Doch durch Denken und Schreiben allein lässt sich einem Kummer nicht beikommen. Dafür muss sie aufstehen und tanzen gehen, muss sie loslassen und alles vergessen. Ein paar Stunden nur, ein paar Tage. Und dann steht Max plötzlich wieder in der Tür ...
Sie sind beste Freunde seit der Schulzeit. Jetzt, mit Anfang dreißig, teilen sie sich eine Wohnung. Max ist Architekt, sie ist Schriftstellerin und seit ihrer Kindheit chronisch krank. Immer wieder wird sie von heftigen Schwindelanfällen heimgesucht und ist auf Max angewiesen. Er ist der Gesunde, sie die Kranke. So war es schon immer. Doch dann erfährt Max vom Tod seines Onkels, und in ihm wächst eine Finsternis. Er muss ins Krankenhaus. Mit einem Mal gerät alles ins Wanken.
Was der Schriftstellerin im aufkommenden Freundschaftskummer hilft, ist das Schreiben, das versuchsweise Ordnen der Vergangenheit in Listenform. Also erzähltsie ihre Geschichte, und damit auch die von Max, von der Nachwendekindheit im Osten bis in die schwankende Gegenwart. Sie denkt über die gesellschaftlichen Verhältnisse nach, die sie zu denen haben werden lassen, die sie sind, über das Kranksein - und die Sprache der Körper.
Doch durch Denken und Schreiben allein lässt sich einem Kummer nicht beikommen. Dafür muss sie aufstehen und tanzen gehen, muss sie loslassen und alles vergessen. Ein paar Stunden nur, ein paar Tage. Und dann steht Max plötzlich wieder in der Tür ...
»Mit assoziativer Lockerheit und Sprachwitz gelingt der Autorin ein erfrischendes Buch über ein schweres Thema.« Martina Läubli NZZ am Sonntag 20240428
Perlentaucher-Notiz zur F.A.Z.-Rezension
Rezensentin Emilia Kröger applaudiert Paula Fürstenberg vor allem dafür, anders als gewohnt über Körperlichkeit und Krankheit zu schreiben. Ihr Roman erzählt von einer namenlosen Protagonistin mit gefährlichen Schwindelanfällen und von ihrem engen Freund und Mitbewohner Max, der nach dem Suizid seines Onkels Angststörungen und eine mittelschwere Depression entwickelt. Wie Fürstenberg dabei zwar metaphorisch schreibt, aber gerade nicht in handelsüblichen Metaphern des Krankseins verfährt - etwa: gesund = aufrecht, krank = liegend - und vor allem der metaphorischen Erschließung des Krankseins als Kriegsschauplatz (Panikattacke, Abwehrkräfte, Hexenschuss) andere, weniger martialische Metaphern entgegensetzt, beeindruckt die Kritikerin. Lobend hebt sie etwa die titelgebenden Weltalltage als Tage, an denen die Protagonistin von Schwindelanfällen erfasst wird und sich wie schwerelos im Weltall fühlt, hervor. Auch mit den Gesunden, die immer erst die Selbstverschuldung vor den möglicherweise krankheitsverursachenden "sozioökonomischen Verhältnissen" sehen wollen, rechne Fürstenberg ab, und nebenher gelinge ihr auch noch ein überzeugendes Porträt einer Freundschaft in der Krise. Für Kröger ein ambitioniertes, aber inhaltlich, sprachlich und "strukturell" überzeugendes Buch, schließt sie.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
Rezensentin Emilia Kröger applaudiert Paula Fürstenberg vor allem dafür, anders als gewohnt über Körperlichkeit und Krankheit zu schreiben. Ihr Roman erzählt von einer namenlosen Protagonistin mit gefährlichen Schwindelanfällen und von ihrem engen Freund und Mitbewohner Max, der nach dem Suizid seines Onkels Angststörungen und eine mittelschwere Depression entwickelt. Wie Fürstenberg dabei zwar metaphorisch schreibt, aber gerade nicht in handelsüblichen Metaphern des Krankseins verfährt - etwa: gesund = aufrecht, krank = liegend - und vor allem der metaphorischen Erschließung des Krankseins als Kriegsschauplatz (Panikattacke, Abwehrkräfte, Hexenschuss) andere, weniger martialische Metaphern entgegensetzt, beeindruckt die Kritikerin. Lobend hebt sie etwa die titelgebenden Weltalltage als Tage, an denen die Protagonistin von Schwindelanfällen erfasst wird und sich wie schwerelos im Weltall fühlt, hervor. Auch mit den Gesunden, die immer erst die Selbstverschuldung vor den möglicherweise krankheitsverursachenden "sozioökonomischen Verhältnissen" sehen wollen, rechne Fürstenberg ab, und nebenher gelinge ihr auch noch ein überzeugendes Porträt einer Freundschaft in der Krise. Für Kröger ein ambitioniertes, aber inhaltlich, sprachlich und "strukturell" überzeugendes Buch, schließt sie.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH