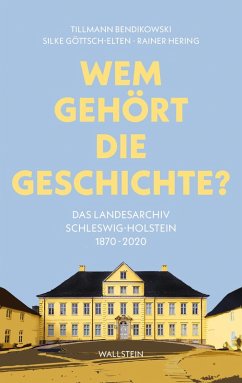Am Beispiel des Landesarchivs Schleswig-Holstein wird nach dem Eigentum an den Quellen gefragt, die Geschichtsschreibung und Rechtssicherheit ermöglichen.Wer Zukunft gestalten will, muss die Vergangenheit kennen. Dabei befinden sich die Quellen für die Geschichtsschreibung unter anderem in Archiven. Archive und Herrschaft sind eng miteinander verbunden. Das 1870 als Preußisches Staatsarchiv gegründete Landesarchiv Schleswig-Holstein hätte es ohne die militärisch erzwungene Reichsgründung nicht gegeben. Über Jahrzehnte war deswegen die Aufteilung von Akten zwischen Dänemark und Preußen strittig. Akten wurden für die Verwaltung benötigt, stellten aber auch nationale, umkämpfte Prestigeobjekte dar. Auch die Darstellung der Vergangenheit ist vom Zugang zu Quellen abhängig. Diese gehörten lange dem preußischen, später dem NS-Staat, der sie für ideologische Zwecke missbrauchte, und erst nach dem Zweiten Weltkrieg den Bürgerinnen und Bürgern.Archive sind Gedächtnisorte der demokratischen Gesellschaft. Wer nicht archiviert, dessen wird nicht erinnert und kann auch selbst nicht erinnern. Archivierung und Zugänglichmachen sind fundamentale demokratische Vorgänge, die Staat, Kommune und Bürgerinnen und Bürgern Erinnerung verschaffen und überhaupt erst ermöglichen.Erstmals wird hier die Geschichte eines staatlichen Archivs in Deutschland von der Gründung bis in die Gegenwart monografisch dargestellt.
»Die Lektüre des flüssig geschriebenen Bandes ist gewinnbringend, und das gleich in mehrfacher Hinsicht. (...) Im Detail wird eine Fülle interessanter Informationen dargeboten, von denen einige kaum oder gar nicht bekannt sein dürften.« (Stephen Schröder, Frankfurter Allgemeine Zeitung, 21.10.2025)