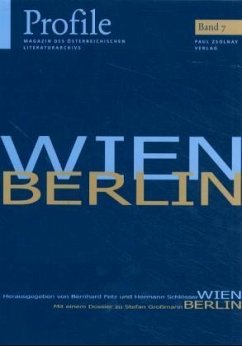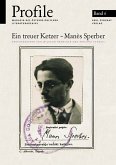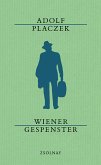Weder die Berliner Publizistik noch das Theater oder der Film der ersten Jahrzehnte des 20. Jahrhunderts sind vorstellbar ohne das Wirken von Wiener Künstlern. Berlin wiederum war für die Wiener, für Alfred Polgar und Robert Musil, für Billy Wilder und Arnold Schönberg, zum Faszinosum und zur Existenzgrundlage geworden: als Stadt des schnellen Geld- und Bilderflusses und als Stadt der am höchsten entwickelten Unterhaltungs- und Medienindustrie.Mit Beiträgen von Elfriede Czurda, Friederike Mayröcker, Jörg Drews, Wendelin Schmidt-Dengler, Kathrin Röggla, Franz Schuh, Gregor Streim, Erhard Schütz, Klaus Völker, Roger Willemsen.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.
Hinweis: Dieser Artikel kann nur an eine deutsche Lieferadresse ausgeliefert werden.