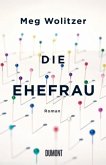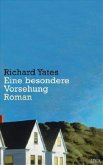Das junge Ehepaar Frank und April Wheeler verkörpert die Kehrseite des amerikanischen Traums der fünfziger Jahre. Unerbittlich demontiert Richard Yates die vermeintliche Idylle der Vorstädte und die Lebenslügen seiner Helden. Mit seinem Romanerstling, in den USA längst ein moderner Klassiker, wurde er zum Leitstern einer ganzen Schriftstellergeneration.
Hinter der pastellfarbenen Fassade der amerikanischen Vorstadthäuser an der "Revolutionary Road" (so der ironische Originaltitel des Romans) lebt das junge Ehepaar Wheeler genau das Leben, das es niemals gewollt hat: Zwei ungeplante Kinder scheinen den Lebensentwürfen der beiden ebenso im Wege zu stehen wie die Beengtheit der Suburbia, die einfältigen Nachbarn oder Franks sinnentleerte Tätigkeit in einem Großraumbüro. April, eine mäßig begabte Schauspielerin, träumt von einem Dasein fernab der Gewöhnlichkeit - von einem Künstlerleben in Paris. Das Paar gibt sich völlig wirklichkeitsfremden Illusionen über die eigenen Möglichkeiten hin und rutscht dabei, ohne es zu merken, tiefer und tiefer in die Spießbürgerlichkeit ab. In ihrem doppelten Egoismus entfremden sich die beiden immer weiter voneinander, ihre Wunschphantasien erweisen sich als Farce. Suggestiv beschreibt Yates den Abgrund, der hinter den Verkleidungen der Wohlanständigkeit lauert, und fördert hellsichtig die fatalen Folgen moderner Lebenslügen zutage.
"Die 'Zeiten des Aufruhrs' fordern uns auf, aufmerksam, umsichtig und wachsam zu sein, das Leben so zu leben, als hinge alles davon ab, was wir tun - denn täten wir es nicht, so setzten wir alles aufs Spiel", schrieb Richard Ford, der in Yates das künstlerische Vorbild der gesamten nachfolgenden Schriftstellergeneration Amerikas verehrt.
Hinter der pastellfarbenen Fassade der amerikanischen Vorstadthäuser an der "Revolutionary Road" (so der ironische Originaltitel des Romans) lebt das junge Ehepaar Wheeler genau das Leben, das es niemals gewollt hat: Zwei ungeplante Kinder scheinen den Lebensentwürfen der beiden ebenso im Wege zu stehen wie die Beengtheit der Suburbia, die einfältigen Nachbarn oder Franks sinnentleerte Tätigkeit in einem Großraumbüro. April, eine mäßig begabte Schauspielerin, träumt von einem Dasein fernab der Gewöhnlichkeit - von einem Künstlerleben in Paris. Das Paar gibt sich völlig wirklichkeitsfremden Illusionen über die eigenen Möglichkeiten hin und rutscht dabei, ohne es zu merken, tiefer und tiefer in die Spießbürgerlichkeit ab. In ihrem doppelten Egoismus entfremden sich die beiden immer weiter voneinander, ihre Wunschphantasien erweisen sich als Farce. Suggestiv beschreibt Yates den Abgrund, der hinter den Verkleidungen der Wohlanständigkeit lauert, und fördert hellsichtig die fatalen Folgen moderner Lebenslügen zutage.
"Die 'Zeiten des Aufruhrs' fordern uns auf, aufmerksam, umsichtig und wachsam zu sein, das Leben so zu leben, als hinge alles davon ab, was wir tun - denn täten wir es nicht, so setzten wir alles aufs Spiel", schrieb Richard Ford, der in Yates das künstlerische Vorbild der gesamten nachfolgenden Schriftstellergeneration Amerikas verehrt.
"Mit 'Zeiten des Aufruhrs' wurde Richard Yates, was er sich als junger Mann so demütig wie größenwahnsinnig gewünscht hat: der Fitzgerald seiner Zeit." Eva Menasse
Perlentaucher-Notiz zur Süddeutsche Zeitung-Rezension
Als "Klassiker der amerikanischen Moderne" würdigt Rezensent Gustav Seibt den amerikanischen Schriftsteller Richard Yates (1926-1992), dessen berühmtester Roman "Zeiten des Aufruhrs" nun in einer "vorzüglichen" deutschen Übersetzung vorliegt. Dass sich Yates trotz der positiven kritischen Resonanz und der Hochachtung durch Kollegen wie Richard Ford oder Joyce Carol Oates nie wirklich durchsetzten konnte, schreibt Seibt auch der bedrückenden Trostlosigkeit seiner Geschichten zu. Auch dem vorliegenden Roman über das Scheitern eines Ausbruchs aus spießiger Umgebung attestiert er eine "erdrückende Unvermeidlichkeit". Doch Seibt findet diesen Roman nicht nur "trostlos", sondern ebenso "bewegend schön". Der Rezensent hebt die "Gegenständlichkeit" von Yates? Erzählen hervor, die er nicht mit einer realistischer Erzählhaltung verwechselt wissen will. Er umschreibt diese Erzählhaltung als "das Homerische unter modernen Bedingungen", nimmt Gustave Flaubert als Beispiel und schwärmt von der "gläsernen, farbigen, sinnlichen Deutlichkeit dieser Kunst", die vieldeutig schillernd und mehrschichtig daherkommt.
© Perlentaucher Medien GmbH
© Perlentaucher Medien GmbH
»Yates schreibt Vorstadt-Tragödien, gibt ein Psycho- und Soziogramm der Fünfzigerjahre, aber er geht weit darüber hinaus: Dieser Roman ist Weltliteratur.« Bayrischer Rundfunk