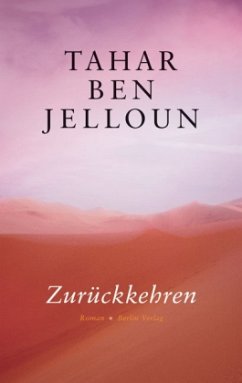Sein Leben lang arbeitet Mohamed bei Renault in Paris. Seine Kinder sind ihm entfremdet, er hat sie an Frankreich verloren. Und er hat nur noch einen Traum: in seiner Heimat Marokko ein Haus zu bauen, in dem er seine Familie wieder zusammenführen kann.
Mohamed ist Muslim, Familienvater und Marokkaner - in dieser Reihenfolge. Und ein vorbildlicher Arbeiter: Vierzig Jahre hat er bei Renault in Paris am Fließband gestanden, Tag für Tag, nie kam er zu spät: Die Arbeit war sein Leben.Jetzt steht ihm die Rente bevor, und er zieht Bilanz: wie er 1962 sein Dorf in Marokko verlässt, nur den Koran in der Hand, der eingeschlagen ist in ein Stück vom Leichentuch seines Vaters und den er nicht lesen kann; die Heirat mit seiner Cousine; seine tiefe Religiosität, die ihm keine Assimilierung an die französischen Sitten gestattet, sein Abscheu aber auch vor den Fanatikern; seine fünf Kinder, die sich ihm entfremdet haben, Lafrance", davon ist er überzeugt, hat ihm zwar Arbeit gegeben, ihm aber seine Kinder gestohlen: Er versteht ihr Französisch nicht, der eine Sohn hat eine Christin geheiratet und der andere, Rachid, nennt sich Richard.Halt findet er nur in einem alten Traum: nach Marokko zurückkehren, um das Haus des Glücks und des Friedens" zu bauen, in dem er seine ganze Familie versammeln kann. Es wird das größte Haus im Dorf, überdimensioniert, mit Gebetsraum, Hamam und Schwimmbecken, nur fehlt es an Wasser und Strom - ein Zement gewordener Wahn. Hier wartet Mohamed auf seine Kinder, er hat sie zum nächsten Aid el Kebir, dem großen Hammelfest, eingeladen. Aber sie werden nicht kommen ...In einem phantasmagorischen Schlussbild lässt Tahar Ben Jelloun seine Figur Mohamed verschwinden. Das Haus wird zum Grab. Und das Dorf hat einen neuen Heiligen, Mohamed, den Immigranten", den Mann, den die Rente getötet hatte".
Mohamed ist Muslim, Familienvater und Marokkaner - in dieser Reihenfolge. Und ein vorbildlicher Arbeiter: Vierzig Jahre hat er bei Renault in Paris am Fließband gestanden, Tag für Tag, nie kam er zu spät: Die Arbeit war sein Leben.Jetzt steht ihm die Rente bevor, und er zieht Bilanz: wie er 1962 sein Dorf in Marokko verlässt, nur den Koran in der Hand, der eingeschlagen ist in ein Stück vom Leichentuch seines Vaters und den er nicht lesen kann; die Heirat mit seiner Cousine; seine tiefe Religiosität, die ihm keine Assimilierung an die französischen Sitten gestattet, sein Abscheu aber auch vor den Fanatikern; seine fünf Kinder, die sich ihm entfremdet haben, Lafrance", davon ist er überzeugt, hat ihm zwar Arbeit gegeben, ihm aber seine Kinder gestohlen: Er versteht ihr Französisch nicht, der eine Sohn hat eine Christin geheiratet und der andere, Rachid, nennt sich Richard.Halt findet er nur in einem alten Traum: nach Marokko zurückkehren, um das Haus des Glücks und des Friedens" zu bauen, in dem er seine ganze Familie versammeln kann. Es wird das größte Haus im Dorf, überdimensioniert, mit Gebetsraum, Hamam und Schwimmbecken, nur fehlt es an Wasser und Strom - ein Zement gewordener Wahn. Hier wartet Mohamed auf seine Kinder, er hat sie zum nächsten Aid el Kebir, dem großen Hammelfest, eingeladen. Aber sie werden nicht kommen ...In einem phantasmagorischen Schlussbild lässt Tahar Ben Jelloun seine Figur Mohamed verschwinden. Das Haus wird zum Grab. Und das Dorf hat einen neuen Heiligen, Mohamed, den Immigranten", den Mann, den die Rente getötet hatte".