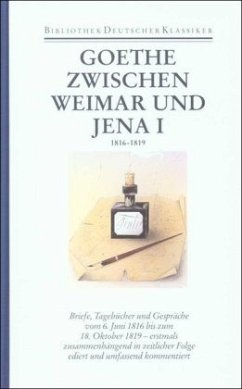"Wohin willst du dich wenden? / Nach Weimar-Jena, der großen Stadt,/ Die an beiden Enden / Viel Gutes hat": so hat Goethe in einer Zahmen Xenie jene beiden Orte als Einheit beschrieben, auf die sich sein Lebenskreis seit dem Tod seiner Frau Christiane am 6. 6. 1816 beschränkt. Markiert wird dieser Lebensabschnitt einerseits durch den endgültigen Rückzug aus den in den Jahren 1814 und 1815 besuchten Rhein- und Maingegenden (und damit den Verzicht auf ein Wiedersehen mit Marianne von Willemer) und andererseits durch die im Sommer 1821 neu entfachte und unerwiderte Leidenschaft zu der damals siebzehnjährigen Ulrike von Levetzow in Marienbad. In beiden Bänden zeigt sich ein unglaublich breites Spektrum des Interesses und der aktiven Beschäftigung: Goethe erscheint darin gleichzeitig als Autor, Minister, gefeierte Exzellenz, Einsiedler, naturforschender "Liebhaber und Dilettant", Kunstförderer und -kritiker, "Großpapa" und nicht zuletzt als verliebter Greis. Die für diese Ausgabe getroffene Auswahl bietet integriert Briefe, Tagebücher und Gespräche. Die vielschichtigen Textinhalte erhellen sich dadurch in wechselseitiger Spiegelung.

Die Abschlussbände der Frankfurter Goethe-Ausgabe
Nicht durch ihren Theoriekurs, sondern durch ihre stille Praxis, nicht durch ihre interpretatorische, sondern durch ihre editorische Leistung wird die deutsche Literaturwissenschaft der achtziger und neunziger Jahre in die Geschichte eingehen. Unter den vielen laufenden Unternehmungen verdienen den größten Respekt die Ausgaben des Deutschen Klassiker Verlags. Ihre Texte sind stets zuverlässig und gut ausgesucht. Ihre Kommentare resümieren in der Regel umfassend den aktuellen Forschungsstand und ersetzen meistens einige Regalmeter Sekundärliteratur. Solide erarbeitet, vernünftig dimensioniert, ansprechend aufgemacht, von diskreten Pionierleistungen voll und trotzdem in rascher Folge erscheinend, thesaurieren diese Bände das literarische Gedächtnis der Deutschen in einem Augenblick, in dem die Tradition abreißen zu wollen scheint. Der Start der Reihe war einst mit großer Skepsis bedacht worden. Die Bedenken verstummen angesichts der einhundertsiebzig Bände, die inzwischen vorliegen.
Das Flaggschiff des Klassiker Verlags ist die Goethe-Ausgabe. Sie firmiert inzwischen, zur Unterscheidung von der ebenfalls hoch achtbaren (Münchener) Ausgabe des Hanser Verlags, allgemein als "Frankfurter Ausgabe" und ist nun, rechtzeitig zum 250. Geburtstag, fertig geworden. Die letzten zwei von insgesamt vierzig Bänden sind anzuzeigen. Eine schöne Eigenart der Frankfurter Ausgabe ist es, dass sie Briefe, Tagebücher und Gespräche in zeitlicher Folge anordnet, so dass wir Goethes Leben beinahe von Tag zu Tag verfolgen können, und das auch noch aus wechselnden Perspektiven, denn manchmal finden wir dasselbe Ereignis in einem Brief, im Tagebuch und im Gespräch mit einem Freund oder Besucher überliefert. Die beiden nun erschienenen Bände werfen uns an fast beliebiger, unauffälliger Stelle in dieses Leben hinein, in eine Zeit ohne große Werke, ohne große Liebesgeschichten, ohne ganz große Politik. Sie setzen ein mit Christianes Tod Anfang Juni 1816 ("Leere und Totenstille in und außer mir") und enden im Dezember 1822 aus keinem anderen Grund als dem, dass irgendwo der nächste Band anfangen muss, auch wenn keine wirkliche Lebenszäsur vorliegt.
Es sind Jahre weit ausgespannter Tätigkeit - die Farbenlehre, die Mineralogie, die Osteologie, der Elektromagnetismus, die Botanik, die Chladnischen Klangfiguren, die Revision der Jenaischen Bibliotheken, Politik, Geschichte und Altertum, natürlich Kunst und Literatur beschäftigen ihn -, so weit ausgespannt, dass die Herausgeberin Dorothea Schäfer-Weiss sich im Nachwort dem Diktum von Gottfried Benn anschließt, Goethe sei "das schöpferische Rätsel schlechthin". (Was unserer Erkenntnis natürlich nicht viel weiterhilft.) Der Motor dieses enormen Fleißes ist im Privaten zu suchen. Goethe leidet, und wie immer flieht er in die Produktion. Die Arbeit ist sein "Talisman gegen die bösen Geister". Vor allem durch Briefeschreiben, manchmal zehn an einem Tag, versucht er das Einsamkeitsleiden zu betäuben.
Christiane fehlt ihm, aber auch noch jemand. "Entbehrung ist ein leidiges Wesen, an sich selbst nichts und das Wenige aufzehrend, was der Tag noch allenfalls enthalten könnte", schreibt er im Oktober 1816 an Marianne von Willemer, die zu besuchen er sich die folgenden Jahre verbietet: "Nicht ohne sehnsüchtige Gefühle scheide ich von diesem Blatt, das, je länger ich dabei verweile, mich immer täuschender dahin versetzt, wohin ich nicht gelangen kann." Die anmutigen Gegenden an Rhein und Main sinken hinab in Traumestiefen. Das Leben dort sei zu leicht, zu heiter, als dass man nicht verwöhnt würde fürs übrige Leben. Liebliche Boten kommen von dort bisweilen, Kistchen mit dem geliebten "Eilfer", zwölf Flaschen Rheingauer enthaltend, "eine Gesellschaft von zwölf Aposteln, welche den besten Segen versprechen". Er returniert ein Wachsmodell seines Kopfes - "ein ernst Gesichte / das im Weiten und im Fernen / Nimmer will Entbehrung lernen."
Die Briefe an das Ehepaar Willemer und an den Freund Carl Friedrich Zelter, mit dem Goethe sich duzt, sind Oasen in einer Wüste von formellen, distanzierten, gelehrten und zeremoniös gezirkelten Schreiben an Hunderte von Empfängern. Die Wüste muss auch er durchmessen haben, traurig und weise, ein Meister des Wortes, das verhüllt, nur selten, wenn die Gewalt, die er sich antut, einmal weicht, auch des Wortes, das mit zarter Geste offenlegt. "Lösest endlich auch einmal / meine Seele ganz": Es ist lange her, dass er das schrieb, solches Gelöstwerden geschieht ihm nur noch selten. Er ist uns sehr fremd, der alte Goethe, er verbirgt sich fast perfekt hinter tausend klugen Gegenständen, die der vortreffliche Kommentar übrigens sorgfältig erschließt. Goethe will gar nicht mehr erkannt werden, jedenfalls nicht von Hinz und Kunz. Er hat sich, wie er an Zelter schreibt, in eine stille Wolke gehüllt - "möge ich sie immer dichter und unzugänglicher um mich versammeln können".
Auswahlausgaben haben gegenüber Gesamtausgaben den großen Vorzug, dass sie strukturieren können. Das geschieht hier mit Geschick. Aus 2600 für diesen Zeitraum überlieferten Briefen wurden 434, aus 2400 Tagebucheintragungen 230, aus 668 Gesprächsberichten 48 aufgenommen. So entsteht eine Lebensdarstellung in autobiographischen Dokumenten, deren Lücken durch den Kommentar zu einer zusammenhängenden Geschichte ergänzt werden. Es ergibt sich ein in jeder Beziehung dichter Text, in dem auch, wer das Biographische verabscheut und nach Sachgehalten sucht, auf seine Kosten kommt. Man kann die Bände als Momentaufnahme der Naturwissenschaft im frühen neunzehnten Jahrhundert lesen. Man kann sich an Goethes politischem Urteil laben - es ist kühl, erfrischend und frei. Man kann sich an der ironischen Liebenswürdigkeit und zierlichen Umständlichkeit seines Stils erfreuen: "Man bittet bei Eröffnung des Päckchens vorsichtig zu verfahren und den Inhalt so wenig als möglich zu erschüttern, welches auch dem Reisenden, der solches mitnimmt, bestens empfohlen worden." Man kann sich von Sentenz zu Sentenz hangeln, immer wieder gepackt von Witz, Treffsicherheit und Bilderreichtum des alten Goethe. "Die jenaischen Druckerpressen sind so hungrig, dass man wie ein Garkoch immer sieden, braten, austeilen und hergeben muss, um sie zu befriedigen. Hier indessen die neuesten Schüsseln und Schüsselchen." Die Lebenszeit ist kurz, aber man kann viel leisten, wenn man sie recht nutzt. "Ich habe keinen Tabak geraucht, nicht Schach gespielt, kurz nichts betrieben, was die Zeit rauben könnte. Ich habe immer die Menschen bedauert, welche nicht wissen, wie sie die Zeit zubringen oder benützen können." Er produziert unermüdlich: "So alt man auch wird, bleibt man immer unmäßig im Unternehmen und wie lüsterne Weiber, der Geburtsschmerzen uneingedenk, sich bald wieder zu neuen Gefahr bringenden Vergnügungen hinreißen lassen, so sind wir Autoren doch auch." Keck spricht er von der Unsterblichkeit, den Beweis dafür müsse jeder in sich selbst tragen, "außer dem kann er nicht gegeben werden". Desgleichen vom Leben nach dem Tode. "Ich habe die recht angelegentliche Hoffnung, dass wir, die wir auf dem Kahne des Lebens so lange zusammen fuhren und schwankten, auch in Charons Nachen unzertrennt hinüberziehen möchten!"
HERMANN KURZKE.
Johann Wolfgang Goethe: "Zwischen Weimar und Jena. Einsam tätiges Alter. Briefe, Tagebücher und Gespräche vom 6. Juni 1816 bis zum 26. Dezember 1822". Sämtliche Werke, Bände 35 und 36. Hrsg. von Dorothea Schäfer-Weiss. Deutscher Klassiker Verlag, Frankfurt am Main 1999. 783 und 797 S., geb., je 140,- DM.
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main