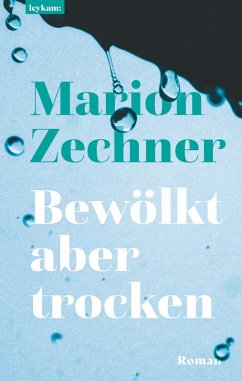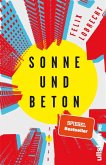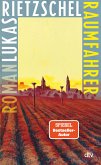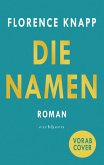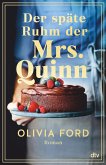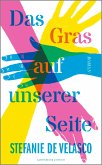Im Roman „Bewölkt aber trocken“ von Marion Zechner wird die berührende Geschichte der alkoholkranken Gymnasiallehrerin Lucy erzählt, die sich - nach einem Autounfall mit ihrem zweijährigen Sohn Jakob - mit Unterstützung ihrer Freundin Marie einer Entziehungskur unterzieht.
Der ständige Wechsel von
Handlungsfortgang und Rückblenden, von „Jetzt“ und „Früher“ (gekennzeichnet durch unterschiedliche…mehrIm Roman „Bewölkt aber trocken“ von Marion Zechner wird die berührende Geschichte der alkoholkranken Gymnasiallehrerin Lucy erzählt, die sich - nach einem Autounfall mit ihrem zweijährigen Sohn Jakob - mit Unterstützung ihrer Freundin Marie einer Entziehungskur unterzieht.
Der ständige Wechsel von Handlungsfortgang und Rückblenden, von „Jetzt“ und „Früher“ (gekennzeichnet durch unterschiedliche Schriftarten) verweist auf Lucys ruhe- und zielloses Denken, Handeln und Fühlen. Ihre Geschichte kann nicht als zeitliches Kontinuum erzählt werden, weil in Lucys Leben Vorstellung und Wirklichkeit durcheinanderkommen.
Das für Lucy Unaussprechbare, ja Undenkbare kann nicht benannt werden, drängt sich aber dem Leser gerade wegen seiner Abwesenheit umso mehr auf. Lucy erliegt nicht ihrem Selbstmitleid, sie will stark sein und keine Schwächen zeigen. Genau dieses Verhalten stellt sich in der Therapie als ein Grund ihres Alkoholismus heraus. Ein weiterer ist die problematische Beziehung zur Mutter, die ihrerseits Alkoholikerin war.
Lucy hat Angst um ihre Ehe mit Lars, auch wenn dieser sie zusammen mit dem gemeinsamen Sohn Jakob für Wochen verlässt. Die Liebe zu Lars, zu Sohn Jakob und zu ihrer vorehelichen, 14-jährigen Tochter Freya steht nie in Frage, auch wenn sie diese Liebe immer weniger zu leben in der Lage ist.
Die Wiederholung von Schlüsselsätzen und -begriffen zeigt auf eine Lucy, die aus einem emotionalen Teufelskreis nicht ausbrechen kann:
„Hauptsache der Wein geht nicht aus“ (15-jährige Tochter Freya hält Lucy den Spiegel vors Gesicht)
Die „Sockenkommode“ (Versteck für allerlei Suchtmittel)
Der „Drache“ (das ewig alkoholverlangende, unüberwindbare Ungeheuer in Lucy)
Sonnenblumenkerne „durchweichen, knacken, kauen, ausspucken“ (damit übersteht Lucy Krisenmomente)
Die Therapie wird im Laufe des Romans konkreter, steuert nicht ohne Risiko auf vorerst unbekannte Ziele zu. Die Therapeutinnen bauen zusammen mit anderen Alkoholikern fast unmerklich einen Kontext um Lucy auf, der es ihr ermöglicht, seit Kindestagen verdrängte Gefühle nicht nur zu erkennen, sondern auch zu akzeptieren, und ihre Schwächen anzuerkennen.
Der Roman hat 450 Seiten, ist detailliert in der Alltagsbeschreibung einer Alkoholikerin, für die Nebensächlichkeiten von großer Bedeutung sind. Das erfordert Disziplin vom Leser, wenngleich die Handlung mit fortschreitendem Text immer mehr an innerer Dramatik gewinnt. Die Lektüre lohnt sich, weil man das Elend eines alkoholkranken Menschen verstehen lernt.
Die Realitätsverweigerung muss aufhören, Selbstdisziplin und Durchhaltevermögen reichen aber nicht, um trocken zu werden. Das Verstehen der eigenen Situation, die schmucklose Selbsterkenntnis sind ebenso wichtig, und das ist nur mit fachkundiger Hilfe von außen möglich.
Ich habe das Buch mit zunehmender Empathie gelesen. Es hat meine Vorstellung von Sucht verändert. Die Lektüre dieses Romans, der mit hoher Sachkenntnis und literarischem Schliff verfasst wurde, macht eindrucksvoll klar, dass der Mensch ohne eigenes Verschulden in eine emotional schwierige, destruktive Lage kommen kann.
Der Roman ist nicht gesellschaftskritisch. Doch kann man schon zur Erkenntnis kommen, dass die Welt, in der wir leben, Opfer fordert, die vielleicht nicht notwendig wären.