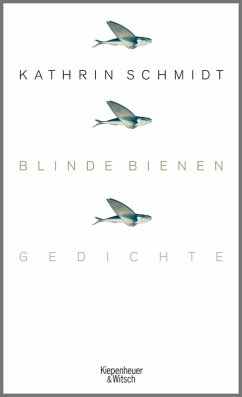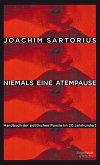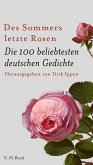Neue Gedichte von der Gewinnerin des Deutschen Buchpreises 2009 Mit ihrem Roman Du stirbst nicht hat Kathrin Schmidt berührend, eindringlich und bestechend komisch die Geschichte einer Rückeroberung des Lebens über die Sprache erzählt. Dieser Gedichtband zeigt, wie verblüffend gelenkig Kathrin Schmidt als Lyrikerin mit Worten balanciert. Ein Lesevergnügen!Motivreichtum, Sprachspiele, Klangvielfalt und frappante Brüche - hier wird alles geboten, was das Gedicht an Möglichkeiten gewährt. Unangestrengt genau, beiläufig bedeutsam, direkt auf den Leser, sein Herz und seinen Verstand gezielt. ein, ausgebe ich einen laut ins luft?zupfe ich aus dem luft einen laut?das luft steht ausgegossen wie spülicht (höricht, fühlicht) zwischen den hauszeilen, deren knotige schriftenins verlassene driften zum ortsrand hin, nebelgelenkeverbinden die domizile der wachsamkeit, das luft hat den fußin der tür, die hand an der klinke, schwelt, sickert insfadenkreuz der gebogenen brauen, von wo es einkatzsprung ist ins kalkül, durch den kopfschießt das luft mit gedoppelter flinte, die tintevergessens löscht aus, was da war, war da was?, das luft wird naß vom gebrauch, schmauchtaus den lungen ins spülicht zurück, fühl ich,hör ich, mein laut hat den ausgang gefunden,ins luft, aus luft
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.