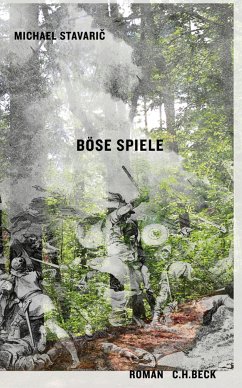Ein Mann, der Ich-Erzähler von «Böse Spiele», liebt eine Frau, die mit einem anderen Mann zusammenlebt und mit ihm ein Kind hat, was nichts daran ändert, dass sie sich immer wieder treffen und nach einander verzehren. Aber da gibt es auch noch die andere Frau, die den Ich-Erzähler vergöttert und alles für ihn tun würde, aber auch alles von ihm verlangt. Absolut packend und virtuos arrangiert erzählt Michael Stavaric in «Böse Spiele» meisterhaft von vier Menschen und ihrer Liebe in einer von allen Regeln befreiten Gesellschaft.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.