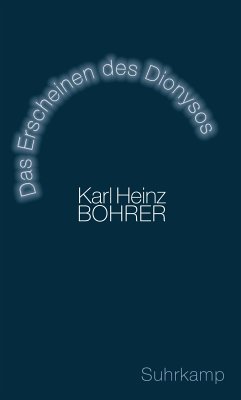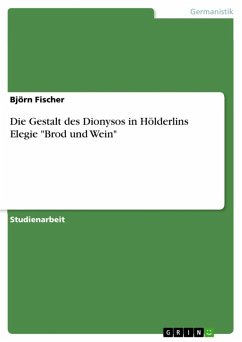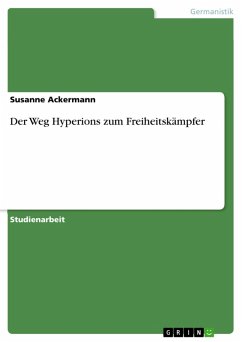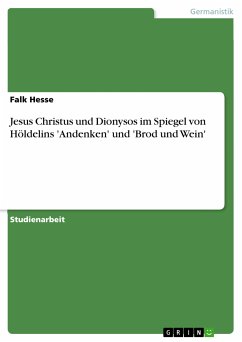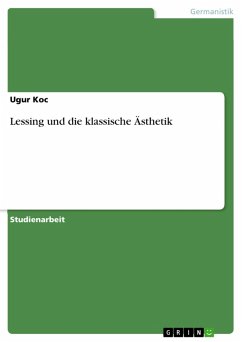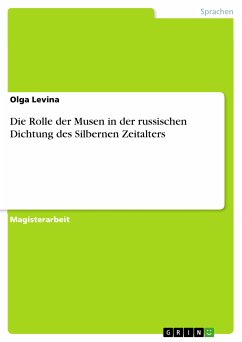Wurde Dionysos erst in der Moderne dionysisch? Dionysos, Sohn des Zeus, Gott der Ekstase, wurden viele Eigenschaften zugeschrieben. Aber nur eine unterscheidet ihn von allen anderen Göttern: sein plötzliches »Erscheinen«, jene mysteriöse Ereignishaftigkeit, die mit seinem Auftreten verbunden war und schon in den griechischen Texten thematisch wurde. Karl Heinz Bohrer begibt sich in seinem neuen Buch auf die Spuren dieser Eigenschaft des Dionysos und zeigt, wie sie sich sukzessive vom Mythos abgelöst hat und nach 1800 zum Signum der romantisch-modernen Literatur und Philosophie wurde. Hölderlins dionysischer Augenblick, Nietzsches dionysische Ästhetik und die mythopoetische Metapher der modernen Lyrik bei Pound, T. S. Eliot, Rilke und Paul Valéry sind die wichtigsten Stationen, an denen das Dionysische des modernen Dionysos erkennbar wird: als Ausdrucksform des »Ereignisses« und des »Erscheinens«, die zu zentralen Kategorien der zeitgenössischen Kunst- und Literaturtheorien werden. Die Diskussion der Theorie des »Ereignisses« im Surrealismus sowie prominent bei Martin Heidegger und Jean-François Lyotard schließt diese fesselnde Studie zum dionysischen Diskurs der Moderne ab.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.