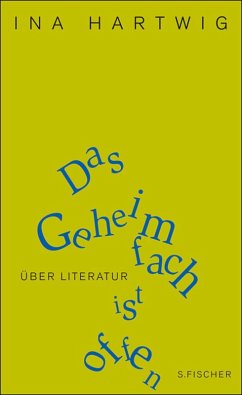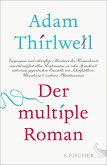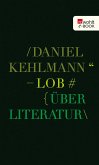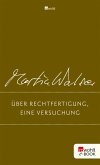Neugier und Leidenschaft verbünden sich, wenn die Kritikerin und Philologin Ina Hartwig über Literatur nachdenkt. Ob es um zärtliche Männer geht, die Abgründe des 20. Jahrhunderts, um die amüsanten Seiten der '68er oder den Glanz der Libertinage: Ihre Essays verbinden analytische Klarheit mit sprachlicher Brillanz, intellektuelle Offenheit mit zeitgeschichtlichem Interesse. Nicht der literarische Kanon steht im Zentrum ihrer Aufmerksamkeit, sondern die passionierte Suche nach den Möglichkeiten und Grenzen des Sagbaren in der Literatur. So bietet dieser Band das sehr persönliche Lektüreprotokoll einer herausragenden Kritikerin und gleichzeitig die erfrischend unkonventionelle Bestandsaufnahme einer Literatur, die hineinreicht in die unmittelbare Gegenwart
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.