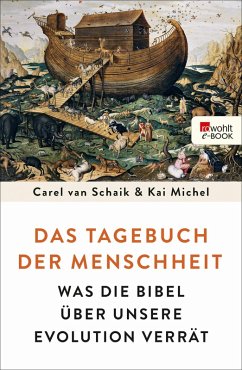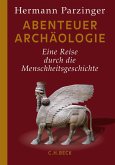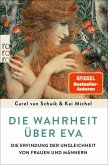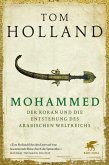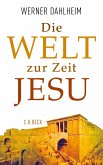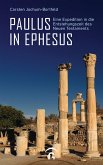Die Vertreibung aus dem Garten Eden markiert das wohl folgenreichste Ereignis der Menschheitsgeschichte: den Übergang vom Leben als Jäger und Sammler zum sesshaften Dasein mit Ackerbau und Viehzucht, das nicht nur zu Fortschritt, sondern auch zu Ungleichheit, Patriarchat und großen, anonymen Gesellschaften führte. Für die daraus resultierenden Probleme waren die Menschen aber weder biologisch noch kulturell gerüstet. Wie sie sich mühsam anpassten, wie sie versuchten, sich auf das bis dahin ungekannte Ausmaß menschlichen Leids in Gestalt von Ausbeutung, Krieg und Krankheiten einen Reim zu machen, das dokumentiert die Bibel auf erstaunliche Weise. Auch zeigt sie, woher das Bedürfnis nach Spiritualität stammt und weshalb die Menschen nicht schon immer die Angst vorm Tod umtrieb.
Die Autoren nehmen uns mit auf eine Reise voller Überraschungen, die von Eden über den Exodus aus Ägypten bis nach Golgatha und zur Apokalypse führt. Dabei eröffnet sich eine neue Perspektive auf die kulturelle Evolution des Menschen und der Religion. Wir begreifen, warum viele der biblischen Probleme uns bis zum heutigen Tage beschäftigen und warum nicht wenige von uns eine Sehnsucht nach dem Paradies verspüren. Die Bibel ist tatsächlich das Buch der Bücher. Sie geht uns selbst dann etwas an, wenn wir gar nicht an Gott glauben.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.