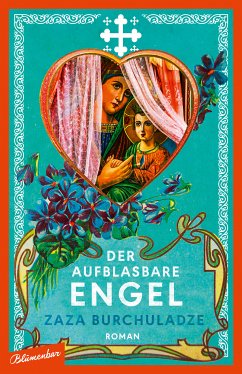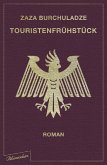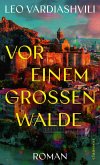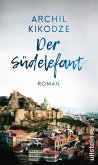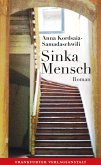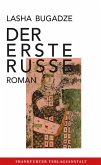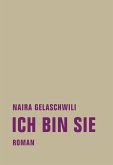Langeweile ist der Grund, weshalb Nino und Niko in ihrer Küche eine Geisterbeschwörung durchführen. Ernsthaft daran glauben tun sie beide nicht und als der Geist von George Gurdjieff vor ihnen steht, sind sie einigermaßen überrascht. Dieser würde gerne nach einer kurzen Stippvisite wieder
verschwinden, aber das will einfach nicht klappen und so muss er wohl notgedrungen für ein paar Tage bei dem…mehrLangeweile ist der Grund, weshalb Nino und Niko in ihrer Küche eine Geisterbeschwörung durchführen. Ernsthaft daran glauben tun sie beide nicht und als der Geist von George Gurdjieff vor ihnen steht, sind sie einigermaßen überrascht. Dieser würde gerne nach einer kurzen Stippvisite wieder verschwinden, aber das will einfach nicht klappen und so muss er wohl notgedrungen für ein paar Tage bei dem georgischen Pärchen unterkommen. Nino und Niko sind fasziniert von dem Mann und seinen Fähigkeiten, eine Internetrecherche enthüllt ihnen, dass sie es wahrhaftig mit einem erstaunlichen Mann zu tun haben und als dieser ihnen Reichtum in Aussicht stellt, können sie das kaum ablehnen – auch wenn dafür eine Entführung notwendig wird.
Zaza Burchuladze konnte mich mit „Der aufblasbare Engel“ einmal mehr durch seinen lakonischen Schreibstil mir subtilem Humor begeistern. Die Handlung ist hochgradig absurd, aber viel entscheidender als das, was erzählt wird, ist das wie und damit kann der Schriftsteller, der seit Jahren im deutschen Exil leben muss, punkten.
Die Figuren sind allesamt auf ihre Weise schräg, allen voran der Geist: ehemaliger Gymnast, Heiler und auch Magier, der nun ein therapeutisches Korsett tragen muss, da er eben auch nicht mehr der Jüngste ist. Seine magische Mütze hilft ihm leider nicht aus dem Dilemma aus der Wohnung der Gorosias verschwinden zu können. Aber das ist nicht das Einzige, was ihn akut belastet, denn auch seine Erinnerung funktioniert nur noch mäßig, wenn er seinen unfreiwilligen Gastgebern seine Lehren nahebringen will, zeichnen sich immer wieder große Lücken ab:
Insbesondere vom vierten Weg. Neben dem Weg des Fakirs, dem Weg des Mönchs und dem Weg des Yogis, sagte er, der sich von den anderen dreien prinzipiell unterscheide. Doch an den Unterschied könne er sich leider nicht mehr erinnern. Übrigens könne er sich ebenfalls nicht erinnern, wie die letzte Folge von Dr. House ausgegangen war, die er am Vorabend gesehen habe.
Das schnelle Geld ist verlockend für Nino und Niko und so stimmen sie der Entführung Nugsar Tschikobawas zu, der in ihrem Haus immer seine Geliebte besucht. Um eine Million reicher halten sie Ausschau nach einer besseren Wohnung, aber nun haben sie neben dem Geist auch noch einen weiteren Mann an der Backe und dieser beginnt auch schon zu stinken und die Polizei wird ebenfalls auf das Treiben in der Wohnung aufmerksam...
Eine kurzweilige Geschichte, die von der Situationskomik und vor allem dem trockenen Humor des Autors lebt. Die Absurditäten und Ironien des Alltags in Georgien, das zwischen Vergangenheit und Zukunft steckt und wo Aberglaube und Kriminalität genauso ihren Platz haben wie das rechtschaffene Leben der einfachen Leute, wird so glaubwürdig abgebildet.