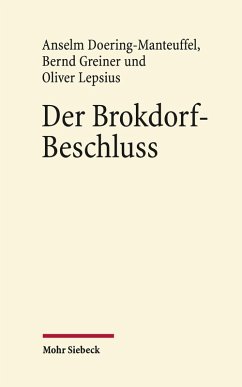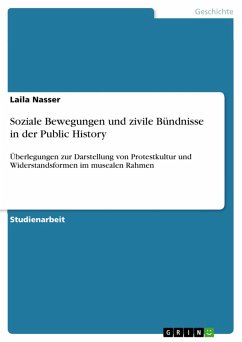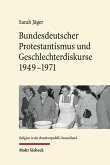Der Beschluss des Bundesverfassungsgerichts vom 14. Mai 1985 über Verbot oder Zulässigkeit von Demonstrationen gegen den Bau des Kernkraftwerks Brokdorf stellt eine zeitgeschichtliche Quelle ersten Ranges dar. Der Text bündelt Belastungen aus der deutschen Geschichte seit der Zwischenkriegszeit und die hartnäckige Auseinandersetzung um 1980 über die Grenzen der Demonstrationsfreiheit. Bestimmungsmerkmale der freiheitlichen Demokratie und des demokratischen Rechtsstaats wurden neu verhandelt, um dem tiefgreifenden Wandel in der Gesellschaft und dem Anspruch auf Mitbestimmung Rechnung zu tragen. Seit den 1960er Jahren waren nicht nur neue Formen des Bürgerprotests entstanden, hatte sich nicht nur die Wohlstandsgesellschaft entfaltet, sondern es gab auch neue soziale und umweltpolitische Herausforderungen. Sie zogen Massenkundgebungen nach sich, die von den staatlichen Instanzen Polizei, Verwaltung und Gerichtswesen nicht angemessen bewältigt werden konnten. Im Zuge der Studentenbewegung seit Mitte der 1960er Jahre und nach dem Aufbruch der Neuen Sozialen Bewegungen im darauffolgenden Jahrzehnt war es längst an der Zeit, das Versammlungsrecht zu reformieren. Die Legislative hatte sich dieser Aufgabe nicht gestellt, so dass bei den politisch und ökologisch motivierten Massenkundgebungen der 1970er Jahre die neuen Formen des Protests und die alten Verhaltensmuster der Ordnungskräfte unvermittelt aufeinanderprallten. Der Band untersucht aus historischer, juristischer und kulturanthropologischer Perspektive die Bedingungen dieses Wandels und erklärt die Eigenart des verfassungsgerichtlichen Urteils.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.