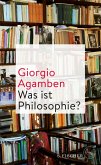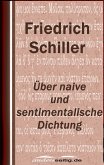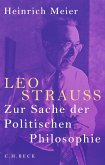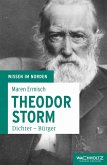Was Dichten und Denken unterscheidet und wie eng das eine mit dem anderen doch zusammengehört, zeigt Amir Eshel in diesem Essay. Dichten ist nach einem Wort von Hannah Arendt Denken ohne Geländer: frei, ungebunden, ein Versuch jenseits einer Systematik. Damit wirkt Dichtung auf das Denken ein. Es gibt ein dichterisches Denken, das Eshel anhand von Gedichten aufzeigt, aber auch an Bildern von Gerhard Richter, an Werken von Dani Karavan und Installationen, die allesamt einen ganzen Zusammenhang ausdrücken. Amir Eshel richtet seine Aufmerksamkeit auf zeitgenössische Künstler, deren Werke Inhumanität und Unfreiheit ins Zentrum rücken und in ihrer künstlerischen Gestaltung einen Ausweg aus der negativen Wirklichkeit, Erfahrung und Einschränkung weisen zu eigenem Denken, zu perspektivischer Weite, die den Anderen in die Betrachtung einbezieht, zu neuen Formen und Inhalten. Und Amir Eshel zeigt, wie wir es lernen können, dichterisch zu denken, denkend zu dichten.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, D, I ausgeliefert werden.