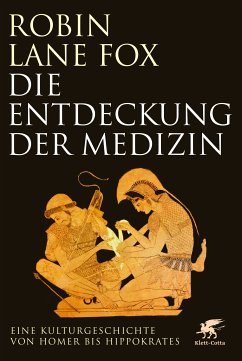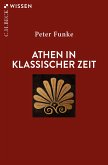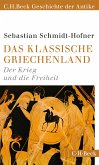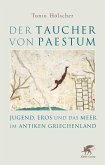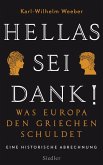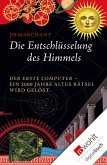Nominiert in der Shortlist zum »Besten Wissenschaftsbuch des Jahres« »Robin Lane Fox' neues meisterhaftes Buch kommt gerade im rechten Augenblick: eine lebendig geschriebene Geschichte der Medizin im antiken Griechenland.« Edith Hall, Literary Review Eindrucksvoll schildert Robin Lane Fox in seinem elegant geschriebenen Buch die bahnbrechenden Leistungen der antiken Griechen in der Medizin und zeigt, wie sie unsere moderne Heilkunst begründeten - mit packenden Schilderungen der Lebenswirklichkeit der Ärzte und der Erfahrungen der Patienten entfaltet er ein großes und noch wenig bekanntes kultur- und geistesgeschichtliches Panorama der Antike. Die antiken Griechen haben bedeutende Leistungen im Bereich der Medizin erbracht. Weltweit wird bis heute der »Hippokratische Eid« von Ärzten und Patienten gleicherweise bewundert: als Gründungsdokument für ethisches Verhalten und ärztliche Ideale. Scharfsinnig untersucht Robin Lane Fox, was wir wirklich über den Eid des Hippokrates wissen, und stellt die faszinierenden Schriften vor, die unter dem Namen dieses Arztes überliefert sind. Seine spannende Darstellung führt uns in die Welt der ersten Ärzte, die in Griechenland und in der ganzen Mittelmeerwelt tätig waren. Auf überraschende Weise erschließt der Autor die Bedeutung der Medizin für die griechischen Geschichtsschreiber (Herodot und Thukydides) und für die großen Dramatiker der attischen Bühne. Dieses anschaulich, lebendig geschriebene und packende Buch eröffnet viele unbekannte und neue Aspekte der Welt des Altertums - die Themen reichen von Frauen-Medizin, Herrschaft, Kunst, Sport bis hin zu Sex und Botanik. Eine außergewöhnliche Reise in die antike Kultur von Homer bis zu den dankbaren Erben in der islamischen Welt und der beginnenden westlichen Moderne.
Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, BG, CY, CZ, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, HR, H, IRL, I, LT, L, LR, M, NL, PL, P, R, S, SLO, SK ausgeliefert werden.