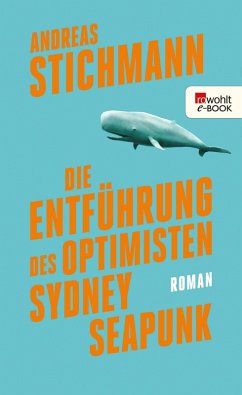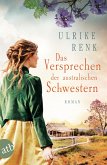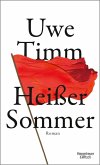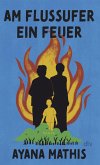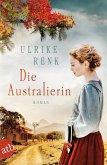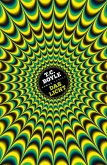Dieser Download kann aus rechtlichen Gründen nur mit Rechnungsadresse in A, B, CY, D, DK, EW, E, FIN, F, GR, IRL, I, L, M, NL, P, S, SLO, SK ausgeliefert werden.

© BÜCHERmagazin, Emily Walton

Ein schöner Spaß: Andreas Stichmann lässt einen Start-up-Robin-Hood auf desillusionierte Weltverbesserer von gestern treffen
Da sitzt also abends eine Bande von schrägen Vögeln beisammen in der ehemaligen linksalternativen Aussteigerkolonie Sonnenhof. Die liegt irgendwo an der A23 in Hamburgs apokalyptisch anmutendem Hinterland, stellt inzwischen eine Art betreutes Wohnprojekt für Spezialbegabte dar, könnte aber ebenso eine Marskolonie der Zukunft sein. Und was schmettern sie dort, einer Hymne gleich? Die klebrige Sehnsuchtsballade "Sailing", in der Version von Rod Stewart bis heute eine der verheerendsten Waffen des Oldie-Radios. Das ist so traurig wie komisch zugleich und bringt die aus verblassten Visionen bestehende, desillusionierte Stimmung des heruntergekommenen Ortes gut auf den Punkt: "Can you heeear mee?" Seit Jahrzehnten hat sie niemand mehr gehört.
Und doch wird hier Großes stattfinden, ein Ausbruch, ein Aufbruch, ein Zusammenbruch. Es hat schon begonnen, denn mit der siebzehnjährigen, Sozialstunden ableistenden Tankstellenräuberin Bibi, in die sich der Leiter der Einrichtung, der Sozialarbeiter Ramafelene, hoffnungslos (und verboten) verliebt, ist das blühende Leben zurückgekehrt. Und genau jetzt taucht noch der seltsame Gast Sydney Seapunk auf. Dessen Weltverbesserungsgerede mag zwar ein wenig armselig wirken, knüpft aber an das Pathos vergangener Zeiten an. Als das Wünschen noch geholfen hat. Und das Träumen. Dass der Sonnenhof gar ein "Power Place" sein könnte, wie es später heißt, ist gar nicht pure Ironie. Andreas Stichmann, Autor von "Jackie in Silber" und "Das große Leuchten", ist ein Spezialist für gerade so weit ins Phantastische verrückte Geschichten rund um verschrobene Existenzen, dass zwar die Ränder verschwimmen, man das Zentrum aber umso klarer sieht. So als sei ein kleiner Bereich kugelförmig aus der Wirklichkeit herausvergrößert worden. Lupenfunktion.
Um Träume also geht es, um die Frage, ob Optimismus nur Mittel zum Zweck ist oder schon ein Ziel an sich. Auf amüsante Weise wuchtet sich Stichmann damit ein gesellschaftlich relevantes Thema auf die Schultern: Sind wild wuchernde Hoffnungen und Utopien nur ein Risiko für den Status quo oder lohnt es vielleicht immer noch, sich dafür zum Affen zu machen? Das Geschehen selbst ist übersichtlich: Der Fremde heißt eigentlich David van Geelen und entstammt der schönen neuen Digitalwirtschaftswelt. Allerdings leitet längst sein Bruder Sebastian das familieneigene Softwareunternehmen; für David blieb viel Zeit, den Weg aller esoterisch verkorksten Silicon-Valley-Visionäre zu gehen. So hat er sich - sein Erbe verjubelnd - als "Focusing-Trainer" neu erfunden und Lebenshilfe-E-Books verfasst. Jetzt wagt der selbsternannte Aktivist, der gern billige Collagen postet, den großen Wurf, nicht aus Empathie, sondern aus Überheblichkeit: Er möchte eine Bewegung in Türkis gründen, die den Welthunger besiegt, indem sie alle Gutverdiener in die Pflicht nimmt.
Um mit gutem Beispiel voranzugehen, will David die eigene Entführung inszenieren, das erpresste Lösegeld spenden und dann "für die Sache" ins Gefängnis gehen. Tatsächlich hat er all die gedrechselten, technophilen Erweckungsphrasen über den Schwarm drauf, mit denen sich Hashtag-Revoluzzer gern schmücken, zumal er weiß, dass eine "politische Ästhetik" heute "auch fancy sein, fruchtig rüberkommen" muss. Und offenbar geht von ihm eine verführerische Energie aus, die nicht nur den leicht behinderten Sonnenhöfler Küwi in ihren Bann zieht. Auch die jugendlich radikale Bibi glaubt an den Plan, pfeift freilich auf Weltverbesserung und plant mit dem erbeuteten Geld bereits ihre Flucht vor dem Jugendamt. Sogar Ramafelenes Mutter, bis dahin ein depressives Biest ("Ich bin post-Lächeln und post-Traurigsein"), wird kurzzeitig schwach. Nur mit einer Entwicklung hat David nicht gerechnet: dass der verliebte Ramafelene, der durchaus vom Neubeginn mit Bibi träumt, sich zu einem Gegner entwickeln würde, und zwar mehr aus Neid als aus Furcht um die Familie. Nun werden wir Zeuge eines Kampfes der Alphatiere (und Ideologien), der wie das gesamte Buch aus alternierender Figurensicht geschildert ist. Die Introspektionen gehen Stichmann gut von der Hand, was an seiner sprachlichen Treffsicherheit liegt. Jeder der sechs Protagonisten hat seinen eigenen Sound.
Da ist freilich etwas Struppiges, Räudiges an diesem Plot. Mit immer energischerem Augenzwinkern ersucht uns die Handlung, sie nicht allzu ernst zu nehmen. Das erinnert in seiner rumpligen Fernsehkomödienhaftigkeit eher an die Romane Tilman Rammstedts als an die letztlich humorlosen Parodien von Dave Eggers, und das ist gut so. Trotzdem ist Stichmann böser als Rammstedt, liefert seine Figuren aus, macht in dunklen Pointen das Lächerliche sowohl der alten als auch der neuen Revoluzzer sichtbar, lässt alle hochfliegenden Pläne in einem Desaster kollabieren - aus dem sich dann der unverbesserliche Optimismus doch wieder hervorkämpft.
Es sind aber gar nicht die großen Konzepte, die diesen schelmischen Roman besonders machen, sondern die oft in wenigen Worten so konturscharf wie komisch gezeichneten Szenen aus dem Inneren des Narrenraumschiffs, das der Sonnenhof zuallererst einmal ist. Rod Stewart am Lagerfeuer, ein verlotterter Hahn als letztes Flügelwesen im Hühnergehege, Küwi mit dem Metalldetektor auf Schrottsuche, Mutter Ingrid, die sich wie ein Kind darüber freut, Davids Psychoratgeber-Tipp der wesensaufhellenden Frisur-Veränderung durch eine Glatzenrasur in Richtung absolute Negativität unterlaufen zu haben - das hat Stil und Humor. Selten genug.
OLIVER JUNGEN
Andreas Stichmann: "Die Entführung des Optimisten Sydney Seapunk." Roman.
Rowohlt Verlag,
Reinbek 2017. 238 S., geb., 19,95 [Euro].
Alle Rechte vorbehalten. © F.A.Z. GmbH, Frankfurt am Main
Perlentaucher-Notiz zur TAZ-Rezension
© Perlentaucher Medien GmbH